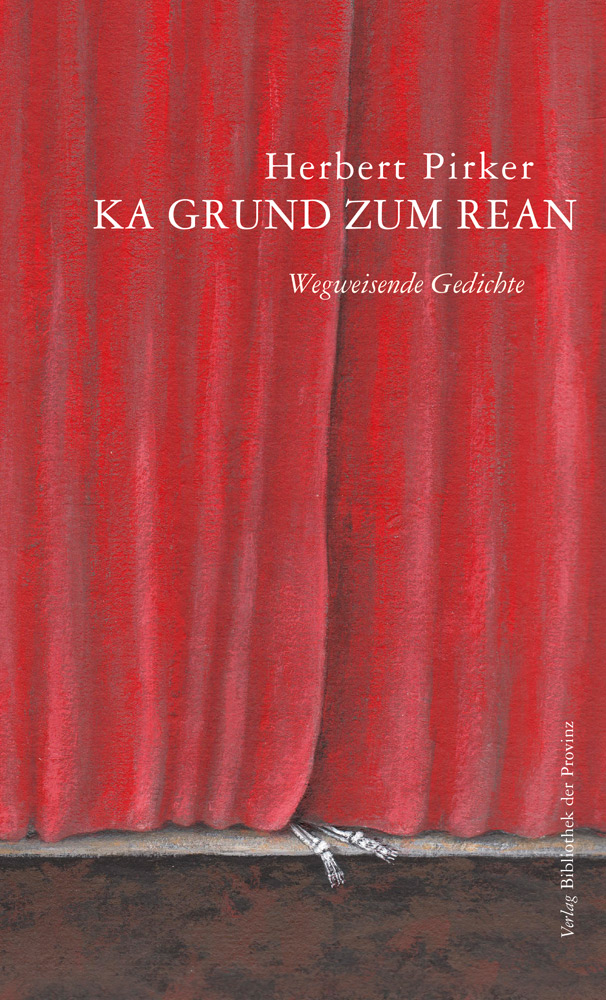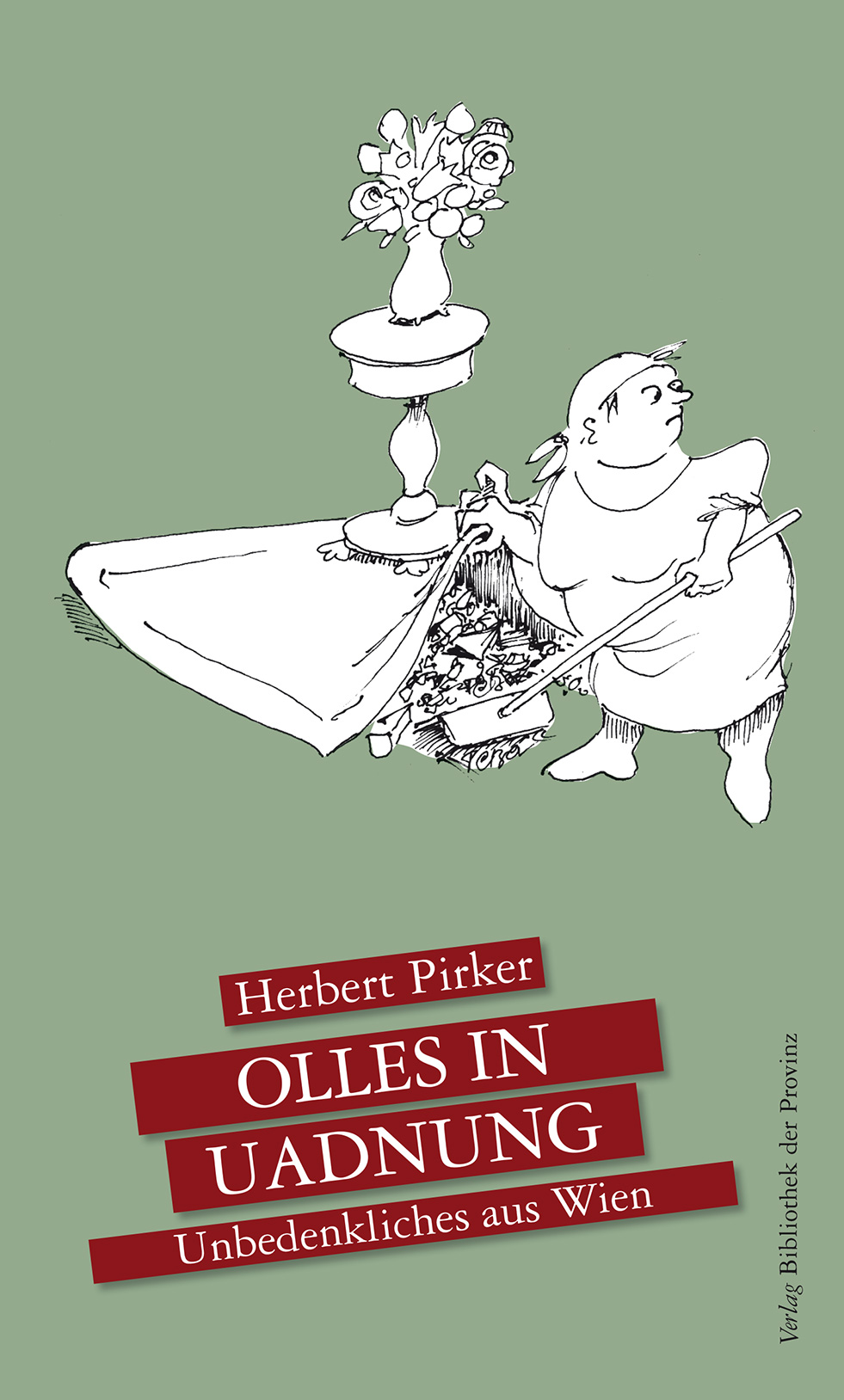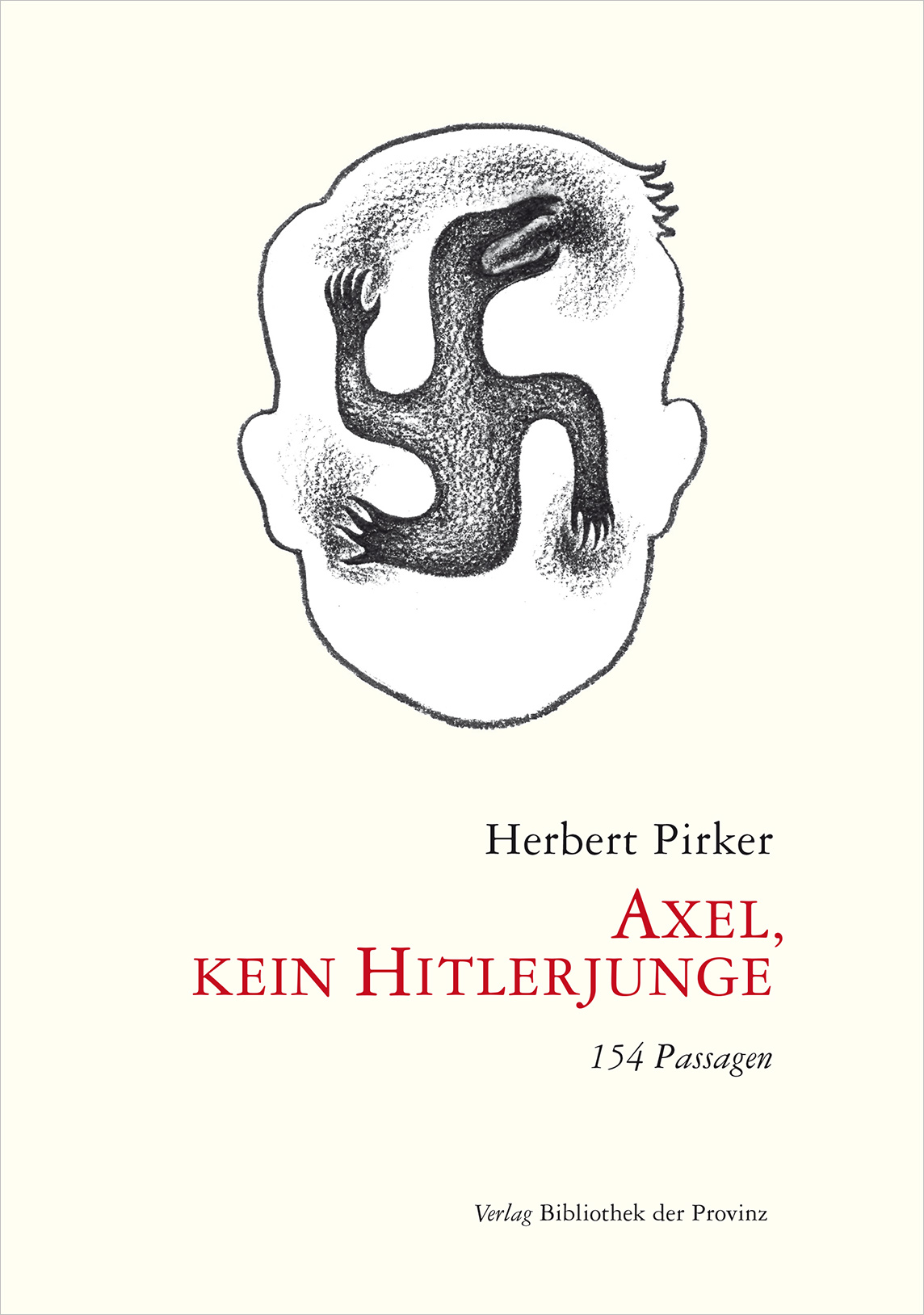
Axel, kein Hitlerjunge
154 Passagen
Herbert Pirker
ISBN: 978-3-99028-135-2
21 x 15 cm, 528 Seiten, Hardcover
28,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
Die sehr persönliche Zeit-Geschichte Axels, eines 1935 geborenen Buben, der seine Kindheit im „Dritten Reich“ und seine Jugend in den Anfängen der Zweiten Republik Österreich erlebt. Wege und Irrwege, Alltag und Überraschungen, Enttäuschungen und Erfreuliches – das alles muss Axel verarbeiten.
Wie er das macht, erleben wir in seiner Augenhöhe mit. Was er draus macht, ist mitunter bemerkenswert, denn seine Umwelt lässt ihn beim Bewältigen größtenteils allein.
[Coverillustration von Arik Brauer.]
Rezensionen
Peter Pisa: Und der Kanarienvogel pfeiftAxel, kein Hitlerjunge. Ein Wiener Bub verarbeitet das „Dritte Reich“
Bisher hielt er sich fast immer zurück, und was er schrieb, Radiogeschichten, Zeitungskolumnen, Mundartgedichte …, das war kurz.
Jetzt gönnt sich Herbert Pirker – 77 ist er – ein dickes Buch, in dem er der Axel ist, ein kleiner Bub in Wien anfangs, der Hitler verehrt, aber kein „Pimpf“ werden darf: Sein Vater stieß einen lästigen Obersturmbannführer, der Axel anwerben wollte, die Stiegen hinunter.
Geduld, Geduld, aus Axel wird ein österreichischer Patriot. Aber der Zehnjährige muss erst lernen, verstehen. Er muss um die tote Freundin weinen. Noch schießt er mit der Schleuder Steine auf Flugzeuge der Amerikaner und Engländer …
„Axel, kein Hitlerjunge“ hat eine sympathische ungekünstelte Sprache und viel zu erzählen. Ein Buch ohne Hänger, mit bleibenden Bildern für diejenigen, die's nicht ohnehin erlebt haben:
Vom Nachbarhaus steht nach einem Fliegerangriff nur noch eine Mauer, und oben, im dritten Stock, da hängt ein Vogelkäfig an der tapezierten Wand mit einem Kanari, und der Kanari pfeift. Axel will ihn holen, mit einer Leiter, und kann in diesem Moment keinen Blick dafür haben, das unter dem Schutt des zerbombten Hauses Menschen liegen.
(Peter Pisa, Rezension im Kurier vom 6. Juli 2013)
Gerhard Zeillinger: Leider doch kein Pimpf!
In „Axel, kein Hitlerjunge“ erzählt Herbert Pirker das Aufwachsen eines 1935 geborenen Knaben, der treuherzig und mit Kinderaugen das Geschehen um sich verfolgt. Dieser naive Blick wird allerdings bis zum Ende durchgehalten.
Wer 1935 geboren ist, hat etwas erlebt: Zeitgeschichte, oder beziffert: 154 Passagen. Diese beschreiben einen Zeitrahmen von 1935 bis zirka 1953. Da hat Axel, der verhinderte Hitlerjunge, gerade seine Matura bestanden und setzt den Schritt ins Erwachsenenleben. Oder richtiger, er wird mit einer griechischen Tragödie konfrontiert, die nach den Erfahrungen der Nazizeit und der Nachkriegsjahre als sehr geballtes Finale einigermaßen fremd anmutet.
Aber der Reihe nach. Axel hätte so gerne ein Pimpf werden wollen. Zuerst kommt Hitler, dann das Christkind. Vorfreude und Glück und so etwas wie Übereinstimmung: Die Begegnung des Sechsjährigen mit dem „sympathischen Führer“, als sich dieser zu ihm hinunterbeugt und ihm zweimal über den Kopf streicht, ist so tiefgehend, dass Axel nachher nicht mehr weiß, ob das wirklich gewesen ist oder ein Traum war. „Er wusste sich eins mit dem Führer, der Führer hatte ihn als seinen Freund erkannt.“ Muss einem das nachher peinlich sein? Ja, es müsste! Aber der Autor pflegt ungebrochen die Perspektive des Kindes weiter, er will jeweils, formuliert er im Vorwort, „auf Augenhöhe“ sein, nicht in einer belehrenden kritischen Position, was freilich auch besser ist als umgekehrt. Aber kann man so etwas wirklich ganz ohne Distanz schreiben?
Der Autor Herbert Pirker, Jahrgang 1935, ist Lesern als Mundartdichter und Kolumnist der „Kronen Zeitung“ sowie als Autor beim ORF bekannt. Nun hat er in einem sehr umfangreichen, vorweg gesagt, viel zu langen Buch seine eigene Kindheit und Jugend zu einem Roman verpackt, wobei völlig unerheblich ist, was er davon auch wirklich selbst erlebt hat und was frei erfunden ist. Also, es fängt damit an, dass er ein „Pimpf“ werden will, doch Axels Vater stößt den Sturmbannführer, der den Buben für die HJ anwerben will, kurzerhand die Stiegen hinunter. Dann kommt der Krieg, und der Krieg erreicht bald auch Wien, und es folgt die Evakuierung ins Innviertel. Axels Vater, der in Wien ein (übrigens arisiertes) Tapezierergeschäft führt, gleichzeitig dort einen Juden versteckt, stößt erst später nach, da stehen die Russen bereits vor Wien.
Auf dem Land erlebt die Familie eine überaus karge Zeit, vor allem Axel, der nicht nur seine Wiener Freunde verliert, sondern auch miterleben muss, wie der Krieg verloren geht. Bald kann man auch im Innviertel Flüchtlinge sehen, „eine minderwertige Art Menschen“, heißt es, „zu denen man nicht freundlich zu sein brauchte“. Das ist schon 1945. Axel macht sich vielmehr Sorgen um seinen geliebten „Führer“. Nicht nur die Chronologie der geschichtlichen Abläufe gerät dabei manchmal abenteuerlich durcheinander; es gibt immer wieder Ungereimtheiten, die einen erstaunen: dass der Krieg schon im April zu Ende ist, dass eine Innviertler Bäuerin Wiener Dialekt redet, dass ein Zehnjähriger ernsthaft mit einer Steinschleuder auf amerikanische Flugzeuge schießt. Schon eher mag man sich vorstellen, wie er einem englischen Soldaten ins Gesicht spuckt, der ihm Schokolade schenken will.
Wie auch immer, der Krieg ist vorbei, irgendwann schafft es die Familie, wieder Fuß zu fassen in Wien. Endlich kann Axel aufs Gymnasium gehen, er wird sogar ein echter Patriot, die rot-weiß-rote Fahne gefällt ihm, die Politiker „imponieren“ ihm – im Hinterkopf aber ist immer noch Hitler und das Tête-à-Tête von damals.
Aber hier geht es nicht nur um Zeitgeschichte. Mit acht wird Axel von der vollbusigen Tante Anni verführt, oder sagen wir besser: missbraucht. Sie lutscht an seinem Glied, und der Bub fragt sich: Gehört sich das? Kurz darauf fordert ein gleichaltriges Mädchen ihn auf, sie zu küssen. Und wieder weiß er nicht, wie ihm geschieht. Dann zwingt ihn gar eine Bäuerin zur Penetration. Da ist Axel wie alt? Zehn, elf? Und das geht? Von frühreif ist nämlich keine Rede, im Gegenteil, als Axel pubertiert, weiß er immer noch nicht, was da eigentlich mit ihm geschehen ist, und das geht so weiter. Wäre es dann nicht spannender gewesen, die kindliche Biografie gleich als Histoire érotique mit zeitgeschichtlichem Hintergrund anzulegen? Aber dazu bräuchte es Fantasie und vor allem sprachliche Raffinesse.
Dass dieses Buch nicht die große Literatur ist, merkt man schon auf den ersten Seiten. Das Erzählen ist ein denkbar einfacher Prozess, das mag authentisch, aber auch eintönig wirken, manchmal auch umständlich und klischeehaft. Was angesichts des Informationswertes schade ist, beschreibt dieses Buch doch sehr dicht den Lebensalltag der Vierziger- und Fünfzigerjahre.
Doch über weite Strecken wird die kindliche Perspektive oft derart strapaziert, dass die Naivität, die sie erzeugen soll, so künstlich wie unglaubwürdig und am Ende mitunter bedenklich ist: „Es war eine harmlose Sache, das mit den Judensternen. Doch ja, dass Juden keine guten Menschen waren, das hörte man oft..., dass man die anderen, die keinen Judenstern tragen mussten, vor jenen mit dem Stern warnte, nun ja, aber richtig böse waren diese Juden nicht.“ Kann man das überhaupt noch als Verflachung des Tons bezeichnen? Überhaupt wenn man dann geschildert bekommt, wie Axel aus einer Zeitschrift einen Judenstern ausschneidet und ihn seiner Mutter an den Mantel näht: „Der Spaß konnte also seinen Lauf nehmen.“
Aber da irritiert noch viel mehr, es ist schließlich ein dickes Buch, und man möchte darin oft einen Kommentar, ein Korrektiv erwarten. Doch eine kritische Distanz des Autors zur Perspektive des Kindes wird nie erkennbar. Diese bleibt verfänglich und schadet dem Buch nicht bloß formal. Von dem merkwürdigen Schluss erst gar nicht zu reden.
(Gerhard Zeillinger, Rezension in der Presse vom 11. Jänner 2014)
https://www.herbert-pirker.at/wp-content/uploads/2014/08/Axel-kein-Hitlerjunge-Rezensionen.pdf