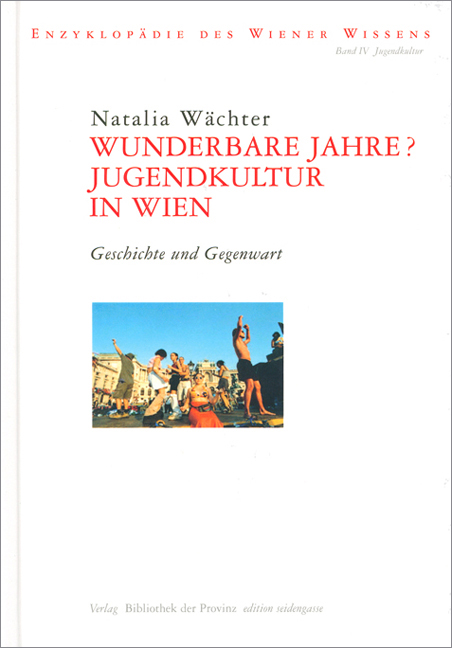
Wunderbare Jahre?
Jugendkultur in Wien · Geschichte und Gegenwart
Natalia Wächter
edition seidengasse: Enzyklopädie des Wiener WissensISBN: 978-3-902416-09-4
21 x 15 cm, 176 Seiten, zahlr. Abb., Hardcover
€ 22,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Kurzbeschreibung
[edition seidengasse | Enzyklopädie des Wiener Wissens, Bd. IV]
Ein Dokumentation über die Geschichte (ab 1900) und die Gegenwart von Jugendbewegungen und Jugendkultur am Beispiel Wiens. Mit einer Auswahl an Fotos, die die geschichtliche Entwicklung veranschaulichen. Mit weiterführenden Anmerkungen und Literaturhinweisen.
Rezensionen
Roman Schweidlenka: Die Wiener Jugendkultur anschaulich aufbereitetGleich vorweggenommen: Das Buch ist zu empfehlen – und das weit über den Wiener LeserInnenkreis hinaus. Die Thematisierung von Jugendkulturen ist Mode. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis ein Buch über die Jugendbewegungen erschien, die Wien im Lauf der Jahrzehnte unsicher machten. Das Buch ist historisch aufbereitet. Los geht es bei dem Beginn des 20. Jahrhunderts: Die österreichische Jugendbewegung, die jüdische Jugendbewegung, Pfadfinderbund, der Verband jugendlicher Arbeiter, die Katholische Jugend werden angesprochen. Interessante Informationen, die bis jetzt nur InsiderInnen bekannt waren, werden so vermittelt. Brisant geht es weiter mit jener Phase von 1919–1938, wo verschiedene linke und rechte Jugendbewegungen in den Bann verschärfter Politisierung, Militarisierung und auch in den Bereich widerständlerischer Aktivitäten gerieten.
In unseren Zeiten provokanter Machtdemonstrationen rechter Jugendlicher ist besonders das Kapitel über die Jugend im Nationalsozialismus zu empfehlen. Hitlerjugend und der Bund deutscher Mädels erinnern daran, dass jene Zeiten nicht heroisch, sondern unselig, voller Repression waren. Die Schlurfs als typische Wiener Erscheinung kommen als Widerstand leistende Jugendliche zu geschichtlichen Ehren. Und auch die rebellischen 68er und ihre NachfolgerInnen sowie die Wiener HausbesetzerInnenszene werden anschaulich beschrieben. Das Buch klingt mit den neuesten Entwicklungen, den verschiedenen Jugendszenen aus. Sorgfältig ausgewähltes Bildmaterial veranschaulicht das geschriebene Wort. Die LeserInnen merken: Wien hat's faustdick hinter den Ohren. Seine Jugendlichen auch.
(Roman Schweidlenka, Rezension in: bn.bibliotheksnachrichten)
https://www.biblio.at/rezonline/ajax.php?action=rezension&medid=46877&rezid=26831
Barbara Zeman: Von den Wandervögeln bis zu den Aegidi-Punks
„Wunderbare Jahre?“: Die Soziologin Natalia Wächter hat eine Geschichte der Jugendbewegungen in Wien verfasst.
Als vor wenigen Wochen bei den Wiener Vorlesungen ein Buch präsentiert wurde, zierte kein Zitat von Goethe, Kant oder Sartre die Einladung, sondern eines der Band Tocotronic: „Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein / Ich möcht' mich auf euch verlassen können / lärmend mit euch durch die Straßen rennen / und jede unserer Handbewegungen hat einen Sinn / weil wir eine Bewegung sind“, las man in den traditionell grünen Lettern auf Karton. Grund des Rückgriffes auf ein Stück jüngerer Popkulturgeschichte: der Band „Wunderbare Jahre? Jugendkultur in Wien“, verfasst von der 36-jährigen Soziologin Natalia Wächter.
Wie lange sie an der ersten durchgängigen Geschichte der Jugendbewegungen Wiens gearbeitet hat, kann die Wahlwienerin kaum abstecken, hat sie doch ihre Diplomarbeit am Institut für Soziologie der Uni Wien über Hardcore in den USA verfasst und ihre Dissertation über die Kommunikation von Wiener Online-Communities. Dazu war sie fast zehn Jahre Kassafrau im Wiener Flex und so zwangsläufig von den Musiken und Dresscodes neuerer Subkulturen umgeben. In ihrem Buch beginnt die Geschichte freilich schon bei den Wandervögeln, Ende des 19.Jahrhunderts.
1894 begannen sich, so Wächter, „Jugendliche in Österreich erstmals als solche zu definieren“: „Junge ArbeiterInnen schlossen sich zum ,Verband der jugendlichen Arbeiter Wiens‘ zusammen“, um der Ausbeutung den Kampf anzusagen. Etwa zur gleichen Zeit legten in Berlin-Steglitz „von Eltern- und Lehrerautoritäten enttäuschte MittelschülerInnen“ mit einer Wanderung im Böhmerwald den Grundstein zum „Wandervogel. Ausschuss für Schülerfahrten“.
Mädchen trugen Hosen!
1911 formierte sich die gleichnamige österreichische Organisation, die aber nicht von den Jugendlichen selbst gegründet wurde, sondern von deutschnationalen Erwachsenen „als Erziehungsbewegung im Sinne des Deutschbürgerlichen Nationalismus“. Der österreichische „Wandervogel“ suchte zwar wie sein deutsches Pendant aus Furcht vor gesellschaftlichem Wandel Schutz in der mystifizierten Natur, gab sich aber auch kriegsverherrlichend und verbot die Aufnahme jüdischer Buben und Mädchen. Diese fanden in den „Bund für jüdisches Jugendwandern in Wien“. Gemein war allen Wandervogel-Gruppen, dass sie durch ihre Kleidung mit der Konvention brachen: Bürgerliche Sprösse trugen bis dahin an ihnen ungesehene kurze Hosen. Auch Mädchen trugen Hosen in der Gruppe um die Zeitschrift „Der Anfang“: Dort hielt man von Wandern und Enthaltsamkeit nicht viel, stellte lieber Autoritäten und Sexualmoral in Frage.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges radikalisierten sich die Jugendbewegungen analog zu den Organisationen der Erwachsenen. 1939 kam die Zwangsmitgliedschaft aller 10- bis 18-jährigen in der HJ, damit das offizielle Ende aller anderen Gruppen.
Widerstand, wenn auch unpolitischen, leisteten auch die „Schlurfs“, die sich ab den frühen Dreißigerjahren ihrem Namen gemäß durch die Straßen Wiens bewegten. Als ihre Nachfolger kann man die Halbstarken der Nachkriegszeit sehen, die sich wie ihre Vorbilder in „Platten“ organisierten. Sie waren – wohl auch angesichts der rasch wechselnden Partei-Bekenntnisse ihrer Elterngeneration – kaum an Politik interessiert, trachteten lieber mit Motorroller und Petticoat Klassengrenzen zu überwinden.
Der nächste Politisierungsschub kam 1968: Diese Bewegung war, so Wächter, „verantwortlich für den späteren Erfolg der Umweltbewegung, der Frauenbewegung“ und auch „Wegbereiterin der Wiener HausbesetzerInnen-Bewegung der Siebziger- und Achtziger“. 1975 wurde der Auslandsschlachthof St.Marx besetzt; 1981 ließen sich Jugendliche in der Aegidigasse nieder.
Damals begann auch in Wien die Ausdifferenzierung der Jugendkultur in verschiedene Subkulturen, die sich über weite Strecken von visionären Zielen abwandten. Die politische Instrumentalisierung der Jugendkulturen in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts wurde, so Wächter, „beginnend mit den Fünfzigerjahren von der kulturindustriellen Vereinnahmung abgelöst. Zudem änderte sich das Verhältnis von Jugendlichen und Erwachsenen: Anstelle der Polarisierung trat eine Vermischung von Erwachsenen- und Jugendkultur ein.“
(Barbara Zeman, Rezension in der Presse vom 2. April 2007)
https://www.diepresse.com/294997/von-den-wandervoegeln-bis-zu-den-aegidi-punks
