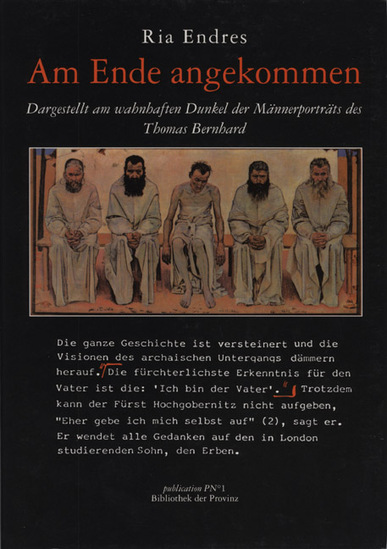
Am Ende angekommen
Dargestellt am wahnhaften Dunkel der Männerporträts des Thomas Bernhard
Ria Endres, Thomas Bernhard
ISBN: 978-3-85252-035-3
21 x 15 cm, 112 S., Hardcover
15,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Kurzbeschreibung
Am Ende angekommen sind die Männer – ihre „Schöpfungen“, diese folgenreichen Aufblähungen ihrer künstlichen Fruchtbarkeit. Die wuchernde Produktionshemmung beweist sich in den Ritualen der Wiederholung, im Schreibzwang, in der Ästhetisierung des Wahnsinns.
Am Beispiel der österreichischen Autors Thomas Bernhard vollzieht Ria Endres die schmerzliche Operation der Erkenntnis. Sie entziffert die „dunklen“ Texte des Autors, der wegen seiner Fixierung an die ungeschriebenen und wirksamen Gesetze des Patriarchats anschreibt: dem universalen Herrschaftsanspruch gehorsam gegen die Natur, gegen die Gesellschaft, gegen Kunst und Wissenschaft.
„Dem automatischen Gehen wird der Vorrang gegeben, denn dieses, immerhin, garantiert Bewegung. Und – der Automatismus ist ja schon seit Jahrzehneten eingerastet. Das Moment des Weitergetriebenwerdens wird allerdings zur Qual. Die Körper funktionieren innerhalb der Maschine des psychischen Apparats als Räderwerk. Manchmal dreht die Maschine durch.“
Thomas Bernhard – Gehen: „… aber nein, kurz bevor wir, wie ich glaubte, den Bahnhof betreten, um uns auf eine dieser Bänke zu setzen, macht Karrer kehrt und rennt auf die Friedensbrücke zu, sagt Oehler, rennt, sagt Oehler mehrere Male, rennt auf die Friedensbrücke zu, am Kleiderhaus Zum Eisenbahner vorbei auf die Friedensbrücke und von dort in den rustenschacherschen Laden, mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit, sagt Oehler.“
„Das Herumgehen in der Stadt Wien ist längst zum Ritual geworden, aus dem es keinen Ausweg gibt. Die Wege führen immer wieder vorbei an den Orten der unbewältigt gebliebenen Geschichte.“
Rezensionen
Rolf Michaelis: Totenschein für die Mann-MaschineGleich mit ihrem ersten Buch, einer Dissertation, stellt die 1946 in Buchloe geborene Autorin einen Totenschein aus. Er gilt der „Kopfmaschine“, der „Denkmaschine“, der „Wortmaschine“ der „Schmerzmaschine“, der „männlichen Sprechmaschine“ – kurz: der Mann-Maschine.
Mit feministischem Furor fordert eine junge Frau die (männliche) Welt der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler heraus in ihrem als Doktorarbeit angenommenen, unverhohlen autobiographischen Dokumentar-Text. Kluge, zum Nachdenken zwingende und oft schöne Sätze stehen hier neben vor Wut blinden Attacken, die trotzig Argumentation verweigern.
„Die Pioniere des Dunkeln kehren von ihren Ausflügen angeschlagen zurück: Sie werden verrückt, verstört, wortkarg, blind… Die Sprachmaschine spricht sich selbst als große Affirmation in die Wiederholung… Was produziert die Maschine? Den männlichen Sprachpilz. Dieser ist das Produkt künstlicher Fruchtbarkeit. Sie soll die Impotenz überdecken. Aber die Produkte des Phallozentrismus sind Totgeburten … Die große Abwehr sinnlicher Bedürfnisse als sexueller Lust geht einher mit der sinnlichen Gebundenheit an das Sprechen. Die Maßlosigkeit, die Sehnsucht nach der Begierde hängt sich in die Superlative … Bei Bernhard wird aus dem Mangel eine aufgeblähte, leere Fülle … Die Sprache schweigt sich mächtig aus… Die unbewußte Phantasie tritt auf als archaisch rächende Natur… Ein leerer Größenwahnsinn breitet sich in den Wörtern aus… Der Autor schreibt Texte gegen den Leib, in denen aber der Leib zum Sprechen kommt… Die Leiber legen sich schwer auf die Gedanken und ersticken sie …“
In solchen Sätzen kräftiger Sinnlichkeit werden die Begriffe der Literaturwissenschaft, der Kritischen Theorie, der Psychoanalyse, des Strukturalismus, mit denen Ria Endres den Texten von Thomas Bernhard auf den Leib rückt, anschaulich, einleuchtend, überzeugend. Die dunklen, komplizierten, raunenden Satz-Ungeheuer Bernhards fallen in sich zusammen: Übrig bleiben Angst-Sätze eines Einsiedlers, der aus lauter Berührungsangst „Die Wörter der Patriarchen“ brav nachbuchstabiert. Ria Endres sieht in den Erzählungen von Thomas Bernhard nichts anderes als die uralt trivialen Fabeln männlicher Phantasie, nur künstlerisch verfeinert. Da wird die Drohung der Autorin aus dem Vorspruch wahr: „Ich werde nicht interpretieren, sondern die Zersetzung eines männlichen Diskurses betreiben, der so dunkel in Ästhetik verpackt ist“: Bernhard erscheint dem sezierenden Blick der Autorin als konservativer Provinz-Chauvi, der aus Angst vor dem Leben, der Natur, der Frau die (Selbst-)Bestätigungs-Gesetze der Väter-Welt nachbetet: Männlicher Herrschaftsanspruch wird nicht in Frage gestellt, der Leib und seine Bedürfnisse werden unterdrückt, der Kopf und seine Hervorbringungen, Kunst und Wissenschaft, verehrt.
Nicht immer geht es so klar zu: Wenn man liest: „Doch meine Gefühle haben sich schon bald mit der dunklen Literatur verknotet“, mag man sich noch etwas denken. Das wird schwerer bei folgendem Satz: „Weshalb sollte gerade das Riechorgan der Männer die Fähigkeit zu denken behalten haben?“
Leichter wäre über diesen wilden Text zu reden, wenn er nicht mit wissenschaftlichem Anspruch präsentiert würde – und die Autorin doch in der Einführung bekennt: „Ich bin dem Tod entronnen.“ Weshalb soll eine Frau ihre Wut auf (die) Männer nicht los werden, indem sie „impotente Männlichkeit“, „männliche Frigidität“, das „schreckliche männliche Geschlecht“, dessen „phallische Morbidität“ und das „Männerklischee der Abstraktheit der Gedanken“ angreift? Als dokumentarischen Text der Befreiung liest man diesen autobiographischen Essay ziemlich atemlos. Auch die literaturkritische Studie bringt neue Erkenntnis. Der Zugang ist zwar nicht neu, ausgehend von der Beobachtung: „Die große Leerstelle in den Texten wird durch die Abwesenheit der Frau (und aller weiblichen Potentiale) verursacht“, aber in der konsequenten Verengung des Blicks faszinierend.
Weshalb dann doch immer wieder das Zögern davor, eine feministische Kampfschrift, aus der viel und vielerlei und gar nicht „nur“ Literarisches zu lernen ist, in der Aufmachung als wissenschaftliche Arbeit willkommen zu heißen? Habe ich nicht diese „Dissertation“ ohne jeden Anfall von Müdigkeit gelesen, was inzwischen geradezu sensationell ist bei sogenannter Sekundärliteratur, einem sonst sicher wirkenden, zudem relativ ungefährlichen Ersatzmittel für Schlafpulver auf chemischer Basis? Oder bin ich insgeheim doch sauer, daß Ria Endres mit einem unscheinbaren Trick von Thomas Bernhards „Männern“ als „den Männern“ schlechthin spricht, „den Männern“ dann Individualität aberkennt und wie bei industriell produzierten Maschinenteilen oder „Kunstwerken“ in Vasarelys Manier nur noch von der „Männerserie“ redet und mir auch noch „Angst“ vor „der Frau“ einzureden versucht? Es hat ja keinen Sinn, so zu tun, als läse ein Kritiker hier „nur“ eine Studie über Thomas Bernhard, nicht auch einen Angriff auf das eigene Geschlecht: „Die Männer, sehen in der Frau immer nur das Nichts … Die letzten Genies wollen ihre Reisen in die Abstraktion ohne die Frau machen. Es gelingt ihnen nicht. In ihren mechanischen Bewegungen liegt das Verbot, in bestimmte Räume vorzudringen. Es sind dies die Räume der Lust, des Traums, des Wahnsinns … der Frau. La femme n’existe pas – aber die Männer sind am Ende angelangt.“
Oder werde ich nur an der Erkenntniskraft einer Studie irre, wenn die Wissenschaftlerin, schon im ersten Satz, päpstlicher als der Papst, verkündet, sie werde die Bücher des Autors, über den sie promoviert hat, „nie mehr öffnen“?
Welche Faszination muß von Wörtern ausgehen, wenn ein(e) Leser(in) sich zu solcher Enthaltsamkeit verurteilt. Welche Angst muß ein(e) Leser(in) vor Büchern haben, wenn ein solcher Fluch ausgesprochen werden kann. Ist das deutsche Wissenschaft 1980, wenn eine aus vielen Gründen erklärliche und verständliche Meinung des Augenblicks als endgültig vorgetragen wird? Braucht nicht alle Wissenschaft, gerade die gern in Ideologie versumpfende oder in Subjektivität aufflatternde Germanistik, ständige Kontrolle durch Revision, also durch neues Lesen, Wiederöffnen der Bücher? Ria Endres bringt solche skeptischen Fragen bereits im ersten Satz ihrer „Doktorarbeit“ zum Schweigen, wenn sie, wie eine Heldin im „Western“, droht: „Ich begleiche eine alte Rechnung.“
Geht man zur Doktor-Prüfung heute wie zum show-down? Ist der Autor, über den man/frau schreibt, ein(e) Gegner(in), den/die es zu vernichten gilt? Mit einer Offenheit, für die wir ihr danken sollten, bekennt Ria Endres schon im Vorspruch eine Befangenheit: „Ich kenne meinen Vater nicht. Er, ein amerikanischer Soldat irischer Abstammung, soll rote Haare gehabt haben. Ich bin ein Besatzungskind“
Nur: was sie als Schreib-Motivation sich zubilligt, verweigert sie Thomas Bernhard: Auch er weiß über seinen Vater nicht mehr, als daß er ein „österreichischer Landwirt“ war. Solch lebensgeschichtliche Details nimmt die Autorin so wenig zur Kenntnis wie die tödliche Krankheit Bernhards in seiner Jugend, die ihn noch heute in Lebensgefahr bringt, wenn er sich in der verpesteten Luft einer Großstadt längere Zeit aufhält. „Die Ursache“ – so nennt Bernhard immerhin den ersten Band seiner Autobiographie. Nach den „Ursachen“ zu wenig geforscht, privat biographische wie allgemein politische Ursachen für Bernhards Art zu schreiben, kaum bedacht zu haben, ist einer der Einwände gegen diese Untersuchung. Das Urteil, diesen Verdacht wird man nicht los, hat die Autorin gegen Bernhard gefällt – nicht, weil er schreibt, wie/was er schreibt, sondern weil es ein Mann ist, der so schreibt.
In einem Antiquariat griff Ria Endres, sie nennt es, rückblickend, natürlich „nicht zufällig“, nach dem Roman „Frost“ von Thomas Bernhard: „Sofort hat mich die Sprache des opaken Provinzzauberers getroffen.“
Bis in den Sprach-Gestus wird die Spannung deutlich, aus der dieses Buch entstanden ist, die es für den Leser spannend macht. „Getroffen“, „sofort“, „Sprache“ –: Diese Wörter stammen noch aus der Vergangenheit des Schock-Erlebnisses, das die Autorin nicht mehr wahrhaben will, wenn sie Bernhard erst mit dem (positiv oder negativ) zu deutenden Ausdruck „Zauberer“ belegt, der aber durch die Vorsilbe „Provinz-“ und das davor gesetzte Adjektiv „opak“ (= undurchsichtig, trüb) zum Scharlatan erniedrigt wird. Mit einem Literatur-Clown hätte sich Ria Endres nicht eingelassen, wenn da nicht doch etwas wäre, das sie – wider Willen – anzieht.
Da wird das schmale Buch interessant. Wir werden Zeugen eines Exorzismus. Ria E. ist Austreiberin und Opfer in einer Person. Die Ersatzfigur für den unbekannten Vater, der (wie Thomas Mann noch) als „Zauberer“ erhöhte Künstler als Ober-Vater, zugleich als „opak“ und „provinziell“ geschmäht, wird endgültig ausgetrieben, in den Schrein seiner Bücher verdammt, die „nie mehr geöffnet“ werden.
Wer auf Sprache so achtet wie Ria Endres und die Leser dazu erzieht, wird sich nicht wundern, wenn die Eigenart der Schlußkapitel ihrer Arbeit bemerkt wird. Am Ende löst sich die Untersuchung von ihrem Gegenstand, befreit sich – auch sprachlich – vollends von jedem diskursiven, geschweige denn analytischen Vorgehen, wird zum begeistert begeisternden Manifest des Feminismus. Das Ziel vor Augen, den Endsieg über die Mann-Maschine, gerät die Autorin ins Schwärmen und ihre Sprache ins Taumeln und Stammeln. Schon die Flucht in Fremdsprachen ist kennzeichnend. Ohne innere oder einsehbare Notwendigkeit heißen die beiden Schlußkapitel, ein bißchen Disco-Sound, ein bißchen Echo der Revolutions-Rufe aus Demonstrations-Tagen: „La femme n’existe pas“ und „Now“. Dazwischen das Prosa-Gedicht aus seligen Zeiten des Living Theater“, die „Sechste Meditation über den politischen Sadomasochismus“ mit der Schlußzeile: „Die Kultur des Todes ist tot.“
Ria Endres, die eben selber Bücher zugeschlagen hat, um sie „nie wieder zu öffnen“, vergißt die Voraussetzungen ihrer Arbeit. Die im Vorspruch bekannt hat: „Manchmal verlasse ich für lange Zeit meinen Schreibtisch, um in die Räume der utopischen Lust einzutauchen. Sie haben helle Farben. Leichten Herzens kann ich mich dann wieder dem dunklen Werk zuwenden“, bereitet sich fast zu einer Art Himmelfahrt vor, wenn sie schreibt: „Nichts ist leichter, als unglücklich zu sein. Die Bücher sind Gräber, in denen man nur allzuleicht versinkt. Es ist geradezu verboten, sie aufzuwühlen. Homogen scheint es dagegen, sich in die Gräber hineinzulegen. Aber es gibt nur einen Weg: Herausspringen. Das erfordert power.“
Da möchte man doch fragen, wer es „verbietet“, sich mit Büchern einzulassen, von mir aus auch: sie „aufzuwühlen“. Weshalb sie „aufwühlen“, wenn man doch in ihnen, wie in „Gräbern“, „allzuleicht versinkt“?
Daß da einiges nicht stimmt, verrät die Flucht aus der deutschen Sprache, der Sprache Thomas Bernhards, von der schönen Kraft zur schicken „power“ ebenso wie das verräterische Adverb „geradezu“, das Ria Endres scheinbar bekräftigend, in Wahrheit abschwächend, vor ihr „Verbot“ rückt. Niemand „verbietet“, und schon gar nicht „geradezu“, Bücher zu lesen, zu öffnen, „aufzuwühlen“ – wenn nicht Ria Endres sich selber. Und „homogen“ kann es weder sein noch scheinen, sich in „Gräber hineinzulegen“, da müßte, wenn schon, ein anderes Fremdwort her.
Aber Ria Endres hat keinen Blick mehr für solche Kleinigkeiten unserer irdischen, und sei es grammatikalischen Wirklichkeit: „Der Fortschritt hat die Männer stolz die Treppe emporsteigen lassen … Nun blicken wir auf die patriarchale Architektur wie in eine kalte Heldengräberlandschaft … Die Frau hat sich hinter dem Mann die Treppe hochgeschlichen. Sie hat sich zwar in seinem Schatten bewegt, aber weniger Abfall hinterlassen. Sie ist im Begriff, aus dem Dunkel herauszutreten, sie ist unsicher, aber sie hat den Wunsch, nach den verschütteten Bestandteilen einer weiblichen Welt zu suchen, die am Treppenrand liegengeblieben sind… Die Chance der Frau ist die: auszusteigen, nicht mehr mitzumachen im Todesritual… Der schöne Traum, die Welt aus den Angeln zu heben, kann immer schwerer geträumt werden …“
So klar, so scharf diese Kritikerin von Thomas Bernhard vieles sieht, so blind ist sie für eine der charakteristischen Eigenarten seines aus der österreichischen Tradition, vor allem Nestroy, zu verstehenden Stils der Mischung von Tragischem und Komischem. Für den (Galgen-)Humor der Erzählungen, der gerade in den finstersten Momenten losbricht, hat Ria Endres kein Gespür – und damit auch nicht für die Tragik in allen Erzählungen. Darf man es sich so einfach machen und tragisches Weltgefühl nur dem männlichen Geschlecht zusprechen, Carla Lonzi zitierend: „Die Tragödie ist eine männliche Projektion“? Ist es nicht eine Frau, die Titelfigur aus Büchners traurigem Lustspiel „Leonce und Lena“, die sagt: „Es kommt mir ein entsetzlicher Gedanke: ich glaube, es gibt Menschen, die unglücklich sind, unheilbar, bloß weil sie sind“?
Wenn Lena aber nur Sprachrohr eines Mannes wäre, der wenig später, keine vierundzwanzig Jahre alt, gestorben ist? Eine andere Frau, Thomas Bernhards österreichische Schriftsteller-Kollegin Ingeborg Bachmann, hat die Eigenart dieses Erzählers früh erkannt – und gelobt: „Wie sehr diese Bücher die Zeit zeigen, was sie gar nicht beabsichtigen, wird eine spätere erkennen, wie eine spätere Zeit Kafka begriffen hat. In diesen Büchern ist alles genau, von der schlimmsten Genauigkeit, wir kennen nur die Sache noch nicht, die hier so genau beschrieben wird-, also uns selber nicht.“
Das soll nicht rechthaberisch klingen. Dazu habe ich aus dem Buch von Ria Endres, auch im Widerspruch, zu viel gelernt. Dies ist eines der wenigen Bücher der letzten Zeit, in die man sich, Ria Endres zu zitieren, „hineinwühlen“ kann – und will. Ein Buch, das weh tut, weil es Einsichten bringt, nicht nur über Thomas Bernhard, sondern auch über den, der sich dieser Lektüre aussetzt.
Für Thomas-Bernhard-Leser: Pflicht. Für Leser, die außer über Literatur-Literatur auch etwas über das Leben in dieser Zeit und eines ihrer wichtigeren Probleme erfahren wollen, das mit „Feminismus“ nur vag umschrieben ist: Kür.
Denn das Buch von Ria Endres sucht, auf seine Weise, Antwort auf die Frage, die ein ähnlich radikaler Erzähler und Dramatiker wie Thomas Bernhard – Hans Henny Jahnn – so formuliert hat: „Es ist unsinnig zu fragen: warum leben wir und warum ist dies und jenes. Alle Fragen beginnen: ‚Warum bin ich Mann und Du Frau.‘“
(Rolf Michaelis zur Ausgabe Frankfurt am Main, 1980, Rezension in der Zeit vom 4. April 1980)
http://www.zeit.de/1980/15/totenschein-fuer-die-mann-maschine
Weitere Bücher des Autor*s im Verlag:

Fresko ohne Blau

Roulett im Föhn
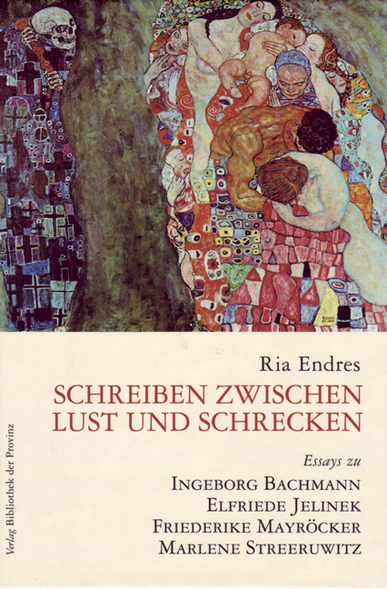
Schreiben zwischen Lust und Schrecken
