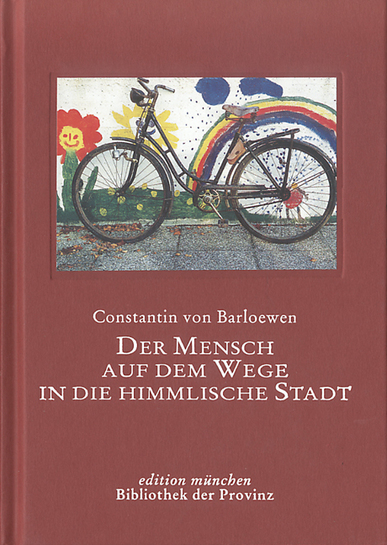
Der Mensch auf dem Wege in die himmlische Stadt
Vom Verlust der Metaphysik und dem Aufbruch in den virtuellen Raum ; Essay
Constantin von Barloewen, Andrea Welker
edition münchenISBN: 978-3-901862-01-4
17 x 12 cm, 32 S.
8,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Kurzbeschreibung
[Hrsg. von Andrea Welker]
Heaven's Gate, die kultische Gemeinde, die den größten Massenselbstmord in der Geschichte der USA ausführte, trug millitaristische Züge. Als ‚Higher Source‘ war der Kult eine Hightech Version und leistete Informationsdienste auf dem Internet. Der Kult wollte nach dem Verlassen des Körpers (‚Container‘) mit einem UFO im Schweif des Kometen Hale-Bopp zum ‚himmlischen Vater‘ aufsteigen.
Rezensionen
Hermann Götz: jenseits vom anderswo: propheten, poeten, schreihälseEin Essay ist erschienen: vom Verlust der Metaphysik und dem Aufbruch in den virtuellen Raum. Hinter den hochtönenden Sätzen des Autors schwimmt uns ein breiter Strom Gegenwartsliteratur entgegen: von der Wiederkehr der Metaphysik und dem Ausbruch wütender Polemik wider den Cyberspace
Es erheben sich Meister des gedruckten Wortes und stimmen ein zorniges Lied an gegen das Wuchern der Wörter im großen Netz. Dichter und Philosophen schlüpfen ins Essayistengewand und beginnen zu polemisieren. Die Bedrohung heißt Internet, Cyberspace, künstliche Intelligenz, sie tönt herüber aus dem virtuellen Raum, und es gilt die Flut der Daten, das Chaos der unwirklichen Scheinwelten, Informationen und Animationen zu übertönen mit Wahrheit, Werten und Wirklichkeit.
Der eine – Neil Postman – attestiert den „Einpeitschern digitaler Verfahren“ einen aggressiven Optimismus, der sie blind mache für Zusammenhänge zwischen Intelligenz, Rationalität, kritischem Urteil und den Formen der Kommunikation. Der andere – Josef Haslinger – sieht die Menschheit der Willkür einer neuen Gottheit ausgeliefert, deren Kirchenfürst – Bill Gates – die Regeln diktiere. Beiden diente das Spectrum, die Wochenendbeilage der Presse, als Sprachrohr. „Der kommende Gott ist allwissend, allmächtig und bestimmt die conditio humana“, so Haslinger. Der Massenselbstmord der sogenannten „High-Tech-Sekte“ Heavens Gate hat bitteren Witzeleien dieser Art längst einen morbiden Anstrich beschert.
Auf in den Cyberspace Gottes
Grund genug für den europäisch-lateinamerikanischen Anthropologen Constantin von Barloewen grimmigen Ernstes die theologische Dimension der virtuellen Wirklichkeit als „technische Form Gottes“ zu diskutieren. Sein Zugang zur Materie ist der des religiös-konservativen Gelehrten, nicht etwa der des durchgeknallten Freaks – wodurch auch die Zielrichtung seiner sprachgewaltigen Lehr- und Leersätze absehbar ist: „Religion vollbringt das, was die virtuellen Realitäten niemals vollbringen können. Sie beschützt den Menschen gegen die Anomie der Bedeutungslosigkeit.“ Mit zahlreichen kritischen Zeitgenossen teilt Barloewen die Angst, dass der virtualisierte Materialismus der Internet-Welt den längst religiös entwurzelten Menschen sich selbst entfremde und in die totale Ortlosigkeit entführe. Ihn jedoch treibt zudem die insgeheime Hoffnung auf eine brauchbare Metaphysik der Zukunft, und so tritt er an, den Cyberspace als für solche Zwecke unbrauchbar zu entlarven.
Der Mensch auf dem Wege in die Himmlische Stadt heißt das schmale Bändchen, das im kleinen „Provinzverlag“ edition münchen erschienen ist. Ausführlich umschweift der Herr Professor darin die Probleme zeitgenössischer Religiosität. Die Moderne ist eine Bewegung hin zur totalen Immanenz, der Begriff der Säkularisierung wurde zu einem Schlüsselbegriff unserer Zeit, lässt er alle wissen, die es noch nicht wissen, Max Weber, Entzauberung der Welt, und so weiter. Trotzdem ist da noch eine stille Sehnsucht: Die Kunst versucht das Geistige zu berühren, Kandinsky, Beuys und Arnulf Rainer – große Namen und große Gefühle. Die schlichte Masse aber treibt ein globalisierungsbedingter Wertepolytheismus fort zur geistlosen Zerstreuung.
Die Lösung heißt: poetisch leben; will heißen: des Lebens wegen leben. Die Mehrzahl der Menschen aber, meint Barloewen, lebe heute schlicht maschinell.
Als großer Ausbruch aus dieser prosaischen Wirklichkeit wolle nun der Aufbruch in virtuelle Welten gelten. Hier darf der Herr Professor Zweifel anmelden. Er sieht viel mehr einen „Krieg der Welten“ heraufdämmern, „einen Krieg zwischen der physikalischen Wirklichkeit und den Kräften des ´Anderswo´.“ In seiner beredten Parteilichkeit gerät sein Essay aber bald ins rhetorische Fahrwasser handfester Weltverschwörung: Neue Möchtegern-Gottheiten, heißt es, würden danach trachten, die physikalische Welt zu verabschieden, da sie der Überzeugung seien, nicht das wirkliche Leben verkörpere die Zukunft des Menschen, sondern die virtuelle Wirklichkeit. Besagte Zweifel aber rütteln am Fundament dieser Götzen:
„Wie stellt sich etwa angesichts der medialen Technologie das Leib-Seele-Problem dar? Kann man wirklich noch sagen, dass die Menschlichkeit mit ‘Seele und Tiefe’ zu tun hat? Weiter mit der Suche nach Sinngebung in einem traditionellen Verständnis? Wo bleibt das Mysterium des Menschen, letztlich seine Individualität?“
Der Mensch verstumme. Er verstumme vor dem medialen Lärm. Sein Schweigen aber sei kein heiliges Schweigen, „das Schweigen schweigt nicht richtig“ – und der Lärm sei kein rechter Lärm mehr, denn er sei traditionslos.
Wahrhaftig sprachlos steht der Leser vor solchen Sätzen. Angelpunkte der Argumentation sind scheinbar unreflektierbare Schönsätze aus der Schatzkiste gediegen gestriger Essayistik. Die Welt als Weihespiel. Oder, mit den Worten des Dichters: „Der Mensch als metaphysisches Tier.“
Das metaphysische Tier
Ganz Anthropologe zeichnet uns Barloewen schließlich dieses „animal quärens“ als ein Wesen, das stets versucht habe, über sich und seine Welt hinauszuwachsen. Der Mensch bleibe sich selbst ein Versprechen, seine metaphysisch-spirituelle Suche sei ein schöpferischer Vorgang, das eigentlich Menschliche sei die Treue zum unfertigen Selbst. In immer neuen Gottesbildern spiegelt sich demnach das stets unfertige Selbstbild des Menschen, dessen zähe Evolution also ein Vehikel seiner eigenen Überhöhung sein soll. Das ist eine interessante und gewinnende Theorie, das historische Bedürfnis des Menschen nach Kult und Religion zu begründen, zumal der Herr Professor uns durch eine kleine Weltgeschichte der Kulturen führt, um seine Ausführungen zu untermauern. Die pointierte Schlussfolgerung daraus aber verrät den essayistischen Denker: Durch die Suche nach Transzendenz also sei der Mensch genuin definiert. „Was ist der Mensch?“, fragt Kant, und Constantin von Barloewen hat die Antwort: Er ist das suchende Tier, das sich (nur) durch seine Frage nach Gott vom übrigen Getier unterscheidet. (Im impliziten „nur“ liegt der essayistische Hund begraben.) Daraus folgt logischerweise die Entmenschlichung des Menschen durch die totale Immanenz. Der gottlose Mensch darf sich nicht mehr Mensch nennen, dem „animal quärens“ ist ein Bastard entwachsen. Der Aufsatz gerät unserem gelehrten Herrn unvermeidlich zur Polemik. Die Notwendigkeit von Transzendenz kann wohl eine innere sein, sie lässt sich aber scheinbar nicht wider alle Säkularisierung verteidigen, ohne die Argumentation durch implizite Wertungen auf zuladen.
[…]
(Hermann Götz, Rezension in: Schreibkraft. Das Feuilletonmagazin #02/03, 2000 [?])
https://schreibkraft.adm.at/ausgaben/02-wiederkehr/jenseits-vom-anderswo-propheten-poeten-schreihalse/
