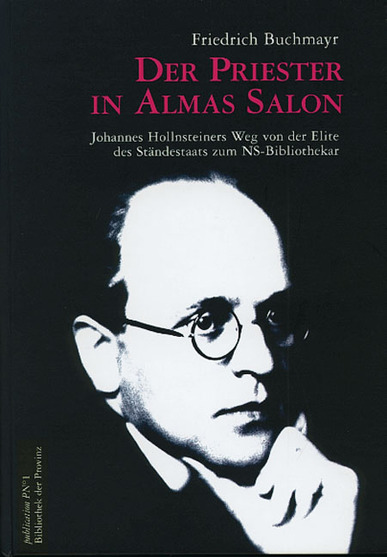
Der Priester in Almas Salon
Johannes Hollnsteiners Weg von der Elite des Ständestaats zum NS-Bibliothekar
Friedrich Buchmayr
ISBN: 978-3-85252-461-0
21 x 15 cm, 336 Seiten, m. Abb., Hardcover
25,00 €
Momentan nicht lieferbar
Kurzbeschreibung
„Die unvergesslichen, schönen Jahre in Wien“
Am 18. Februar 1955 schrieb Alma Mahler-Werfel nach vielen Jahren des Schweigens einen Brief an jenen Mann, der zwischen 1932 und 1938 in Wien ihr geistlicher Begleiter und Vertrauter gewesen war.
Nach ihrer Flucht ins amerikanische Exil hatte sich die Salondame der Wiener Moderne zunächst empört von ihm abgewendet, weil ihr Unglaubliches zu Ohren gekommen war. Der einstige Freund und Berater des österreichischen Bundeskanzlers Kurt Schuschnigg soll nach dem Anschluss Österreichs zu den Nationalsozialisten übergelaufen sein, hieß es, und er, der ihr einmal als Inbegriff eines Priesters erschienen war, hätte aufgrund einer Affäre mit einer deutschen Opernsängerin Orden und Kirche verlassen. Die briefliche Selbstrechtfertigung des Betroffenen vom Juni 1945 konnte zwar Almas Ehemann Franz Werfel, nicht aber sie selbst überzeugen.
Sein Buchmanuskript Ein Österreicher erlebt den Nationalsozialismus vom Sommer 1945 wollte sie gar nicht erst lesen. Er war und blieb für sie fortan ein doppelter Verräter: in politischer Hinsicht, vor allem aber in religiöser.
Als sie 1947 das erste und einzige Mal nach dem Krieg Wien besuchte, um ihre Eigentumsverhältnisse zu regeln, weigerte sich Alma Mahler-Werfel, mit ihm zu sprechen. Aber Jahre später, eben am 18. Februar 1955, meldete sie sich dann doch bei ihm.
18.2.55
Liebster Freund
Ich bitte Dich, mir mitzuteilen ob und wie Du lebst – ob Du zufrieden bist…?! – etc und ob Du Dich manchmal meiner erinnerst!? –
Ich grüße Dich
Alma Mahler Werfel
Der Brief ging zunächst nach Wien zu Ida Gebauer, Almas langjähriger Haushälterin, die ihn Monate später persönlich zum Adressaten, Johannes Hollnsteiner, nach Linz in Oberösterreich brachte.
Mit großer Betroffenheit hatte der einst zur Elite des Ständestaats zählende Theologieprofessor die Verurteilung seiner Haltung in den Jahren des Nationalsozialismus durch die frühere Freundin hingenommen. Nach einigen vergeblichen brieflichen Gegendarstellungen war Hollnsteiner so ernüchtert gewesen, dass er ab 1947 jegliche weitere Kontaktnahme unterließ. Der unerwartete Brief aus New York überwältigte ihn und rief ihm die folgenschwerste Begegnung seines Lebens ins Gedächtnis zurück.
Linz, 23.5.55
Meine liebste Alma!
Du kannst nicht wissen, – oder eigentlich müßtest Du es doch – welch ein Geschenk Du mir mit Deinem kurzen u. doch viel sagendem [sic!] Briefchen vom 18.2. gemacht hast […]
Alma, Du frägst, ob ich mich manchmal Deiner erinnere! Als ob ich einen Menschen, der wie kein anderer in mein Leben eingriff, je vergessen könnte! Ich hatte vor Deinem Wiener Aufenthalt Schulli gebeten, Dir über mich zu berichten, Mißverständnisse, böswilligen Tratsch aufzuklären u. ich hatte so sehr auf Deinen Ruf zu einer Aussprache nach Wien gewartet. Ich war so überzeugt, Du würdest mich verstehen u. ich litt schwer darunter, daß Dein Ruf ausblieb, ja ein späterer Brief an Schulli keine Antwort fand. […]
Immer aber habe ich mit Liebe und Dankbarkeit an Dich gedacht, an die unvergeßlichen, schönen Jahre in Wien, als Du mich aus meiner Enge herausholtest, meinen Horizont weitetest und mir unvergeßbares Erleben schenktest. Ich wurde durch Dich, an Deiner Hand ein anderer Mensch.
Rezensionen
Michaela Schlögl: Alma Mahlers SeelenfreundDer Priester und Professor Johannes Hollnsteiner war eine schillernde Figur im Ständestaat und während des Nationalsozialismus
Johannes Hollnsteiner war ein Zeit lang KZ-Häftling, führte aber zu anderen Zeiten Adolf Hitler durch das Stift St. Florian und wurde dennoch 1945 entnazifiziert. Er war erst Priester, später der Ehemann einer Opernsängerin. Bekannt geworden ist Hollnsteiner aber vor allem als „Priester in Almas Salon“. Alma Mahler-Werfel, die Freundin berühmter Männer, war auch Hollnsteiner zugetan. Sämtliche Facetten dieser Beziehung sind detailreich überliefert: der blässliche, intellektuelle Gottesmann, der nicht lieben darf, und doch von der Femme fatale als Opfer auserkoren wird … Stoff für eine Story, die Journalisten unter der Rubrik „Priester und die Frauen“ abhandeln könnten.
Doch wirklich spannend ist die Lebengeschichte des 1895 in Linz geborenen Hollnsteiner nicht wegen ihrer amourösen, sondern ihrer politischen Dimension – die freilich ohne die Begegnung mit Alma nicht denkbar gewesen wäre. 1932 beschloss die Witwe Gustav Mahlers nach einem nicht gerade klösterlichen Lebenwandel, in die katholische Kirche einzutreten. Zu ihrem geistlichen Begleiter erkor sie den damals 37-jährigen Theologen Hollnsteiner, der als Augustiner-Chorherr des Stiftes St. Florian ein fanatischer Verfechter des politischen Katholizismus war.
Als Stammgast von Almas illustrer Salongesellschaft in der legendären Hoffmann-Villa auf der Hohen Warte wurde Hollnsteiner in die High Society des Ständestaates eingeführt und rasch zum „Promi-Priester“ im Gefolge von Bundeskanzler Kurt Schuschnigg, dessen Beichtvater er gewesen sein soll. Klaus Mann, der Almas konservative politische Neigungen keineswegs teilte, schrieb: „Frau Alma, die Schuschnigg und seinem Kreis nahestand, machte den Salon, wo tout Vienne sich traf: Regierung, Kirche, Diplomatie, Literatur, Musik, Theater – es war alles da. Die Hausfrau, hochgewachsen, sorgfältig geschmückt, von immer noch schöner Miene und Gestalt, bewegte sich triumphierend vom Päpstlichen Nuntius zu Richard Strauss oder Arnold Schönberg, vom Minister zum Heldentenor, von stilvoll vertrottelten alten Aristokraten zum vielversprechenden jungen Dichter …“
Zu dieser illustren Runde gehörte also auch der Priester. Auf den ersten Blick bar jeglicher Casanova-Ausstrahlung, war er doch gestylt und ein wenig overdressed und faszinierte dank seiner sprühenden Intelligenz, Belesenheit und einer Prise Zynismus. Seit 1934 war Hollnsteiner nicht nur Universitätsprofessor, er hatte auch ein gesellschaftspolitisch sensibles Amt inne. Als Gerichtspräsident am Wiener Metropolitan- und Diözesangericht war er in zwei pikante Eheannullierungen des Ständestaates involviert, die freilich streng geheim vollzogen wurden. Es handelte sich um die Fälle des Heimwehrführers Ernst Rüdiger von Starhemberg (seine Frau, eine geborene Altgräfin Salm-Reifferscheidt-Raitz, hatte einen Annullierungsantrag gestellt; nach tatsächlicher Nichtigkeitserklärung konnte Starhemberg seine Geliebte, eine Burgschauspielerin, heiraten), sowie um die des verwitweten Bundeskanzlers selbst. Schuschnigg hatte sich in Vera, geb. Gräfin von Czernin-Chudenitz, verliebt, die allerdings verheiratet war und vier Kinder hatte. Ihre Ehe wurde 1936 geschieden, 1937 erfolgte die kirchliche Annullierung …
Interventionen
Der „Anschluss“ beendete jäh die steile gesellschaftliche und berufliche Karriere des Gelehrten und „Chefideologen Schuschniggs“ (Friedrich Heer). Die dramatischen politischen Ereignisse warfen Hollnsteiner aus der Bahn und in eine wahre Achterbahn von politisch bedingten Serpentinen. „Es gab in seiner Generation nicht viele Personen, die sowohl in einem Konzentrationslager der Nationalsozialisten als auch in einem Entnazifizierungslager waren“, umschreibt Biograph Friedrich Buchmayr die Auswirkungen des Hitlerregimes auf Hollnsteiners Lebensweg. Anlässlich der Neuordnung der Akten der Reichsrundfunkgesellschaft im Stiftsarchiv St. Florian und der Entdeckung von Hollnsteiners Nachlass, der sich in Privatbesitz befindet, kamen vor einigen Jahren erstaunliche Puzzleteile seines Schicksals ans Tageslicht.
Doch der Reihe nach. Hollnsteiner war ein geübter Intervenierer – um das Wort „Intrigant“ zu vermeiden. Als beispielsweise Thomas Mann 1936 in der „Neuen Zürcher Zeitung“ erstmals offen gegen die Nazis opponierte, wurde ihm dafür die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen. Mann kam nach Wien und hörte einen der politischen Vorträge Hollnsteiners über das historische Abendland christlicher Prägung (das er der nationalsozialistischen Idee rassischer Prägung entgegensetzte.) Vor allem aber versuchte der Dichter, seine Chancen zu sondieren, die österreichische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Auf Intervention Hollnsteiners stellte Bundeskanzler Schuschnigg die sofortige Verleihung in Aussicht, doch nahm Thomas Mann 1936 schließlich die tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft an.
Hollnsteiner ließ seine Beziehungen nicht nur zu Gunsten von Künstlern spielen, er intrigierte auch erfolgreich gegen einen Entwurf Fritz Wotrubas für ein Gustav-Mahler-Denkmahl in Wien und wandte sich auf polemische Weise in einer als läppisch einzustufenden Causa an den Bundeskanzler: Staatsoperndirektor Weingartner („der eine Jüdin nach der anderen zur Frau genommen hat“, so Hollnsteiner zu Schuschnigg) sollte abgesetzt werden, weil Frau Alma nicht über die Verrückung der Mahler-Büste Auguste Rodins in der Staatsoper informiert worden war!
Bald sollten Zeiten kommen, in denen Hollnsteiner selbst „Intervention“ gebraucht hätte. Alma hatte Hollnsteiner nach dem „Anschluss“ dringend empfohlen, „belastende“ Dokumente wie Briefe und Manuskripte, zu verbrennen, aber er war dabei nicht gründlich genug vorgegangen. Bereits in der Nacht vom 13. auf den 14. März durchwühlte die Gestapo Hollnsteiners Wiener Wohnung und stieß auf Briefe von Thomas Mann und Bücher von Franz Werfel.
Am 30. März 1938 wurde Hollnsteiner, der nicht für Hitlers Drittes Reich, sondern für eine Reichsidee unter österreichischer Führung schwärmte, von der Gestapo verhaftet und nach Dachau deportiert.
Gemeinsam mit einem Kabarettisten (höchstwahrscheinlich Fritz Grünbaum), dessen besonders grausame Erniedrigung Hollnsteiner während der Deportations-Zugfahrt miterlebte, erreichte er das Konzentrationslager, in dem Hollnsteiner elf Monate einsaß.
„Aus Universitätsprofessor Dekan DDr. Johannes Hollnsteiner wurde nun der Schutzhaftgefangene Nr. 14.234. Ein SS-Wachmann schlug ihm wegen seines Doktortitels ins Gesicht und rief ihm zu: Du Dreckschwein, wir werden dir den Doktor schon geben“ (Friedrich Buchmayr). Hollnsteiner überlebte, trotz schwerster körperlicher Zwangsarbeit und argen Schikanen – nicht zuletzt dank seines Stubenältesten Castello, einem seit 1933 inhaftierten Kommunisten, der ihn unter Umgehung der Lagervorschriften vor mancher Strafe bewahrte. Hollnsteiner, der während des Ständestaates in Sozialisten und Kommunisten Erzfeinde sah, zählte ihn später zu den „wertvollsten Menschen“ seines Lebens.
Als nach internationalen Protesten „die meisten österreichischen Häftlinge aus dem bürgerlich-katholisch-konservativen Bereich noch vor Kriegsausbruch 1939 aus dem KZ entlassen“ wurden (Buchmayr), kam auch Hollensteiner frei. Voraussetzung dafür war eine Loyalitätserklärung für das NS-Regime.
Brief an die Gestapo
Er ging zurück nach St. Florian. „Jetzt“, so Biograph Buchmayr im Gespräch, „kommt für mich die Wende. Wenn ich im voraus gewusst hätte, dass ich diesen Brief finde – ich weiß nicht, ob ich das Buch gemacht hätte.“ Gemeint ist eine 6-seitige „Denkschrift“ an die Gestapo, in der Hollnsteiner erklärt, er wolle „nicht weiterhin von der Teilnahme am Leben und Streben der Volksgemeinschaft ausgeschaltet“ sein. „Der Gestapobrief war in seiner Einseitigkeit als Entlastungsschreiben eine Umdeutung und Verfälschung der eigenen Vergangenheit“ (Buchmayr).
Im April 1941 trat Hollnsteiner der NSV (Nationalsozialistische Wohlfahrt) bei. Das war zwar keine Parteiorganisation der NSDAP, aber ein ihr angeschlossener Verband. Am 5. September 1941 verließ er den Orden und am 7. September 1941 heiratete er standesamtlich die geschiedene Wagner-Sängerin Almut Schönigh. Hollnsteiner blieb im Stift St. Florian, mit dem Hitler „Großes“ vorhatte. St. Florian war Sitz des Reichsrundfunks, es bestanden Pläne für eine Bruckner-Musikstätte, ein Museum, sowie für den Ausbau als „Alterssitz des Führers“.
1943 wurde Adolf Hitler von Hollnsteiner, nun Bibliotheksleiter in St. Florian, durch das Stift geführt. Das war zwar nicht geplant, doch Hitler hatte sich nach einem Besuch der Linzer Rüstungsbetriebe spontan für einen St. Florian-Besuch entschieden, und der Linzer Führer konnte die Detailfragen Hitlers nicht befriedigend beantworten. Hollnsteiner, der als Schlüsselwart anwesend war, sprang sachkundig ein.
Als St. Florian 1945 den Augustiner-Chorherrn zurückgegeben wurde, lebte Hollnsteiner mit Frau und Tochter in der Dienstwohnung. Im Oktober 1945 wurde er von einem amerikanischen Divisionspfarrer abgeführt und in das amerikanische Internierungslager für Nazis und Kriegsverbrecher in Glasenbach überstellt.
Nach 19 Monaten Haft kam Hollnsteiner frei. Auf die Kriegszeit in St. Florian angesprochen, erklärte er später, er hätte „durch drei Jahre den Auftrag, den größten Teil der beschlagnahmten Stiftsbibliotheken zum Verkauf zu bringen, unter verschiedenen Vorwänden nicht ausgeführt und dadurch Millionenwerte für Österreich gerettet …“ 1948 wurde Hollnsteiner rehabilitiert, als Universitätsprofessor jedoch zwangspensioniert.
Seine Vortragstätigkeit setzte er aber fort – die Themen unterschieden sich allerdings eklatant von denen des „Priesters in Almas Salon“. Aus dem strengen Katholiken und Ständestaatstheoretiker war ein „Vermittler“ geworden. Die Zukunft des Abendlandes sah er jetzt, nicht zuletzt „bekehrt“ durch die Begegnung mit dem Kommunisten Castello, im Zusammenspiel zwischen Christentum und Sozialismus. Hollnsteiner engagierte sich für die UNO und wurde Freimaurer.
Eine konnte ihm seinen „mehrfachen Verrat“ niemals verzeihen: Alma. Sie hatte nur noch Verachtung für Hollnsteiner übrig, obwohl sie ihm einst schwärmerisch anvertraut hatte: „Ich liebe Dich, – ich liebe Dein Wirken in der Welt und auf mich …“ Später lautete ihr strenges Urteil über den „Gefallenen“: „Zielstrebig war er immer. Das wusste ich … eitel, selbstisch, aber da war eine Glaubensmauer, so dachte ich, unübersteiglich … und jetzt legt er eine Parteileiter an, und sehe da – Gott donnert nicht – die Mauer IST ersteigbar und man lebt wieder angenehm – hat nun eine Frau – ja vielleicht HAT dieser Gott nie existiert, alles war ein Holler … Und Eines, was ich ihm NIE verzeihen werde – er hat mir den Katholizismus wanken gemacht in mir selbst.“ (Alma Mahler, Tagebuch 1941).
Der Biograph sieht Hollnsteiners Charakter objektiv: „In seiner Wandlungsfähigkeit war er ein moderner Mensch mit einer multiplen Identität. Er wollte sich überall beliebt machen und wurde Opfer seines Ehrgeizes. Aber selbst, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte: Er wäre trotzdem nichts mehr geworden.“
(Michaela Schlögl, Rezension in der Wiener Zeitung vom 15. Februar 2008)
