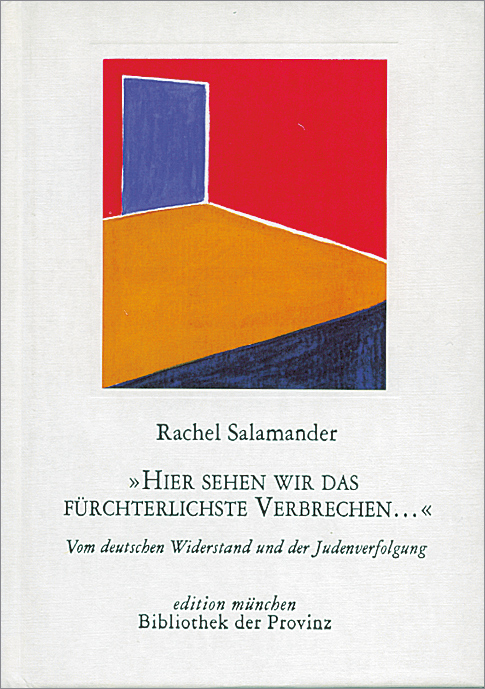
»Hier sehen wir das fürchterlichste Verbrechen …«
Vom deutschen Widerstand und der Judenverfolgung · [Gedächtnisvorlesung zur Erinnerung an die Opfer der »Weißen Rose«, Ludwig-Maximilians-Universität München, 23. Februar 2000]
Rachel Salamander, Andrea Welker
edition münchenISBN: 978-3-901862-09-0
17,5 x 12 cm, 48 Seiten, Hardcover
10,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Kurzbeschreibung
Soweit meine Rückerinnerung reicht, gehört die Judenverfolgung und Judenvernichtung zu meinem Leben. Sie sind Grundtatsachen meiner Existenz, ohne daß ich ihnen selbst unterworfen gewesen wäre. Ich kann daher bei diesem Thema keine historisierende Perspektive einnehmen. Distanzierende Werturteilsneutralität ist hier ohnehin Illusion. Unter ihnen auf die Welt gekommen, ist das Schicksal der Überlebenden Teil meiner selbst. Ihre Biografien leben mit mir weiter. […]
[Hrsg. von Andrea Welker]
Rezensionen
Evelyn Ebrahim Nahooray: [Rezension]Rachel Salamander wurde in einem Camp für Displaced Persons geboren, dort und in anderen Lagern hat sie die ersten Jahre ihrer Kindheit verbracht. Die Einwohner waren alle Überlebende des Holocaust und so meint sie, dass Judenverfolgung und Judenvernichtung zu ihrem Leben gehört hätten, ohne dass sie diesen selbst ausgesetzt gewesen war. Es ist daher verständlich, dass sie bereits als Kind mehrmals die Frage stellte, ob denn die Juden keine Hilfe von ihrer Umwelt bekommen hätten, als Antwort erhielt sie immer ein Nein.
Später hörte sie vom deutschen Widerstand, meist im Zusammenhang mit dem Attentat vom 20. Juli 1944. Aber trotz aller Bewunderung für die daran Beteiligten musste sie erkennen, dass dieser Umsturzversuch nicht wegen der Verfolgung der Juden geschah; sowie es keinen organisierten Widerstand gegen Entrechtung und Vernichtung der Juden gab, nur einzelne Menschen, die unter Lebensgefahr auf verschiedenste Art halfen.
Die einzige Ausnahme bildete die Gruppe um die „Weiße Rose“, denn sie zeigte in ihren Flugblättern klar die Verbrechen der SS und der Wehrmacht an den Juden auf. Rachel Salamander sieht ihre Beschäftigung mit dem deutschen Widerstand als desillusionierend an, nur eben die „Weiße Rose“ rage als das große Beispiel heraus.
(Evelyn Ebrahim Nahooray, Rezension in: David. Jüdische Kulturzeitschrift, 18. Jg., Nr. 71, Dezember 2006, S. 69)
Frankfurter Allgemeine Zeitung: [Rezension]
Rachel Salamander fragt in ihrer Vorlesung zur Erinnerung an die Opfer der „Weißen Rose“ nach dem Unerklärlichen der Holocaust-Forschung: Wie konnte dieses Verbrechen der Menschheit geschehen, während ein ganzes Volk tatenlos zusah? Das Hauptaugenmerk der Rede, die bereits in dieser Zeitung veröffentlicht wurde, richtet sich auf den organisierten Widerstand, den Rachel Salamander mit Hans Mommsen als „Widerstand ohne Volk“ charakterisiert. Während der konservative Widerstandskreis, der schließlich zum Attentat vom 20. Juli führte, sich nicht in erster Linie durch die Judenverfolgung zum Handeln veranlaßt sah, scheiterten die Aktionen der „Weißen Rose“ an der Teilnahmslosigkeit der Deutschen. Rachel Salamander macht deutlich, daß der Mut der Mitglieder der „Weißen Rose“ nicht von den Deutschen vereinnahmt werden kann. Man hätte damals, so Rachel Salamander, von den Verbrechen wissen können.
(Rezension in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Nr. 235/00 vom 10. Oktober 2000, S. 50)
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezension-sachbuch-literatur-11318121.html
