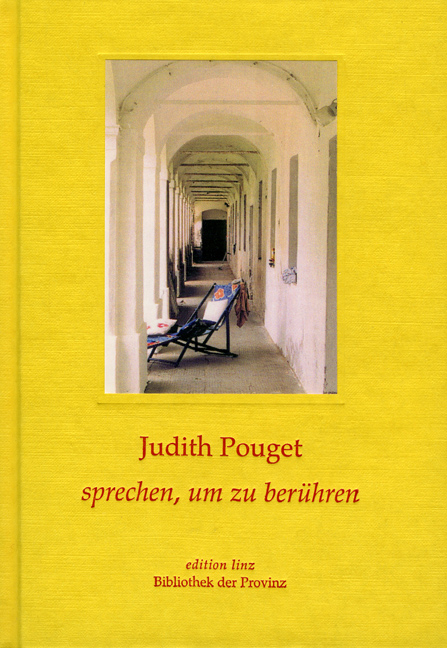
sprechen, um zu berühren
Briefjournal eines Sommers
Judith Pouget
edition linzISBN: 978-3-85252-583-9
17 x 12 cm, 80 S., Hardcover
13,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Kurzbeschreibung
Es ist spät, mein Lieber, elf Uhr; ich bin gerade nach Hause gekommen. Diese Nachtfahrten sind von einer Einsamkeit, die sich über mich legt wie eine schwere Decke und alles zum Verstummen bringt, bis ich mich fühle, als könne ich nie wieder den Mund aufmachen und ein Wort reden. Lesen, rauchen, am Rande des Bewußtseins über die vergangenen Tage nachdenken – Bilder tauchen auf, Gesprächsfetzen, aber es ist unmöglich, direkt daran zu denken. Dann ankommen in Linz, auf dem öden Bahnhof, durch die Baustelle hinaufwandern zur Straßenbahn, warten im Nieselregen. Stumme Menschen, jeder in seinem eigenen nächtlichen Blues versunken, nur zwei junge Polizisten diskutieren mit einem angetrunkenen Mann, nicht unfreundlich. Mit der Straßenbahn durch die ausgestorbene Stadt fahren, aussteigen, durch die leere Unterführung gehen, mit hallenden Schritten; auf der Rudolfstraße ein paar Autos, ihre Scheinwerfer lassen Schaufenster und Plakatwände aufleuchten. Den Park entlang wandern, zwischen Häuserfronten und blühenden Bäumen; die Nacht duftet nach Lindenblüten. Die Tür aufsperren; wie jedesmal nach längerer Abwesenheit verwundert und erleichtert, daß das Haus noch steht. Das Licht einschalten in der Küche; vertrauter Geruch; die Einsamkeit der leeren Wohnung schlägt mir entgegen. Stille. Und jetzt sitze ich hier an meinem Küchentisch, verwirrt, betäubt, müde – und nicht wirklich fähig, den abrupten Wechsel zu begreifen zwischen den Wohnungen, den Orten, den Leben.
Rezensionen
Christian Pichler: Nähe durch SpracheEin stilles Buch, gerade einmal achtzig Seiten dünn. Der Rezensent hat es an einem Abend geradezu verschlungen und außerordentlich genossen. Es ist die Geschichte eines Sommers – jenes Sommers, als in den zentraleuropäischen Ländern die Flüsse über die Ufer traten (Dummköpfe sprachen und schrieben von einer „Jahrhundertflut”, Anm.). Eine Frau beschließt, für ihren abwesenden (realen?) Geliebten Tagebuch zu führen – „sprechen, um zu berühren” (so auch der Titel des Buches), Sprache stellt hier Nähe her.
Kaum etwas passiert, und doch geschieht so viel. Zwei Mal eine Woche zu Besuch bei einer Freundin im Burgenland, mehr an Abwechslung bietet dieser Sommer der Ich-Erzählerin nicht. Der Rest ist Alltag, die Mühsal in der Ödnis eines Büros, Ausflüge zu nahe gelegenen Seen, hin und wieder abends Bier trinken mit Bekannten.
Warum mich dieses Buch dennoch so gefesselt hat? – Ganz klar, es ist die wunderbar unspektakuläre und dennoch so eindringliche Sprache der 1959 in Oberösterreich geborenen Judith Pouget; ihr geradezu impressionistischer Stil, der unauffällige Dinge zum Leuchten bringt. Es ist die Beobachtungsgabe der Autorin, sowohl in der Selbstreflexion als auch von Naturerscheinungen. Eine Beobachtungsgabe, die, wie Pouget treffend, aber ohne jedes Selbstmitleid feststellt, immer wieder mit Phasen der Schwermut bezahlt werden muss. Und es ist tatsächlich – eigentlich ein Unwort in Zeiten pornographischer Selbstentblößungen im TV – das „Authentische” dieser Aufzeichnungen, die unaufdringliche Aufrichtigkeit von Pouget.
Einmal, fast am Ende von „sprechen, um zu berühren” „passiert” tatsächlich etwas. Die Ich-Erzählerin lässt sich mit Verdacht auf Brustkrebs untersuchen. Nach Stunden bangen Wartens, der Angst und der Tränen erweist sich der Verdacht als unbegründet. Doch ein Entschluss ist gefasst: das Leben auskosten zu wollen: „Und weißt du, was bei all dem der stärkste Gedanke war? Das Gefühl, das jede Angst noch überlagerte? Da war ein Gefühl der Auflehnung, der Wut. Und der Gedanke: Ich will nicht sterben – nicht, bevor ich richtig gelebt habe. Nicht jetzt.
Und das werde ich auch nicht. Aber die Erfahrung des gestrigen Tages hat mir eines klar gemacht: Ich will darum kämpfen, das Leben leben zu können, was ich leben will. Egal, was es kostet – an Schmerz, Angst, Sehnsucht und (Ver-)Zweifeln.”
(Christian Pichler, Rezension auf dem Website des Stifterhaus Linz)
Frank Keil-Behrens: Kleiner großer Schatz
Heute schon über den Sommer geärgert? Zu kalt, zu warm, zu nass oder zu trocken kommt er mal wieder daher? Egal. Es gibt ein kleines Büchlein, das in jedem Fall hilft. Geschrieben von Judith Pouget.
Am Anfang steht der Schock. In Gestalt des Titels: sprechen, um zu berühren. Tatsächlich, so steht es da. Kleingeschrieben und kursiv gedruckt. Das muss man doch jetzt weglegen! Das wird doch jetzt furchtbar werden. Oder? Immerhin klingt der Untertitel mit Briefjournal eines Sommers dagegen angenehm neutral. Na gut – man kann ja mal anfangen zu lesen. Ein, zwei Seiten; vielleicht drei.
Und nun? Wie jetzt den Bogen hin bekommen und erklären, dass sich hinter jenem unglaublich kitschigem Titel ein ganz wunderbares Buch verbirgt? Eines, das nichts und gleichzeitig alles erzählt? Tja – das ist nicht recht zu erklären; das muss gelesen werden.
Wie immer kann man sich erst mal zu den Autorinnendaten flüchten: Pouget, Judith; geboren 1959 in Oberösterreich, zwei Jahre Aufenthalt in den USA; Übersetzungen für Film und Theater; verschiedene literarische Beiträge in den „Facetten“ und in „kursiv“. Offenbar also keine so genannten größeren Veröffentlichungen, Romane, Gedicht- oder Erzählbände. Nichts, was sagt: Hallo, die Frau ist gut und wichtig und schon richtig bekannt und das bestimmt zu recht. Auch gut.
Verdichtetes Tagebuch
„Es ist spät mein Lieber, elf Uhr; ich bin gerade nach Hause gekommen.“ So beginnt Pougets kleines Büchlein und damit ist schon das Thema vorgegeben: Eine Frau kommt nach Hause, sie sitzt zu Hause und sie denkt an ihren Liebsten und weil sie es nicht mit dem an ihn denken belassen will, schreibt sie ihm in der Küche auf ihrem Laptop einen Brief. Berichtet, was heute vorgefallen ist, wie das Wetter steht, wer vorbeikam und wie sie dann möglicherweise zu zweit in einer Bierstube saßen und über was man sich unterhielt. Und es braucht nur wenige Momente und man wird beim Lesen dieser tagbuchartigen Ausführungen (die – das wird nicht groß überraschen – keineswegs ungelenk herunter geschrieben wurden, sondern verdichtet und klarsichtig sich erheben) ruhiger, entspannter, ja: empfindsamer.
Mit immer wachsenderem Interesse verfolgt man alsbald die Tagesberichte, ist bald mit dabei, wenn die Erzählerin aufs Fahrrad steigt, wenn sie im Dunkeln noch vor der Tür steht und in den Himmel schaut. Eine Wespe sticht ihr aufs Augenlid, eine Freundin übernachtet bei ihr, sie ist unterwegs in die Stadt, die Linz heißt und an der Donau liegt, die mal schmutzig braunes Wasser führt, mal helles und klares. Sie sitzt vor dem Küchenradio, sie raucht genussvoll eine Zigarette, sie liest in dem Indienbuch von Naipaul, sie will sich hinsetzen und schreiben, aber ihr steht der Sinn nicht danach und so hadert sie so lange, bis sie aufsteht und das Schreiben Schreiben sein lässt, wie sie ihrem Liebsten schreibend beichtet.
Parallel vollzieht sich der Sommer. Mit kühlen Tagen, mit massiver Hitze, die umschlägt in wolkenbruchartige Regengüsse, dass die flusswärts gelegenen Sträßchen Linz’ unter Wasser stehen. Das Korn wächst und wird gelb. Die Bäume erblühen und lassen ihre Blätter sich wieder spröde einkringeln, so vergeht also die Zeit.
Verästelter Kosmos des Alltags
Gewiss, das alles kennt man; meint man zu kennen. Jenen Blick auf den eigenen Alltag, das tägliche Aufstehen, das tägliche Zubettgehen, das so großartig ist für einen selbst und – angeblich – so nichtssagend sein soll, erzählt man es anderen. Was nicht stimmt, wie wir wissen (hoffentlich).
In diesem Sinne ist das Buch eine Erziehungsmaßnahme. Es setzt darauf, den eigenen Alltag wahrzunehmen, ihn zu seinem persönlichen Kosmos zu erheben und ihn in all seinen Verästelungen zu bemerken. Es setzt auf Pausen, auf Stille, auf Innehalten und – sehr angenehm – bleibt strikt dabei, statt hinter dem Rücken mit irgendwelchem philosophisch-religiösem Budenzauber zu winken, der uns doch nur wieder antreiben, weil anfeuern soll. Es beharrt stattdessen darauf, wachen Sinnes durch die Welt zu gehen; aufmerksam zu bleiben, auch gerade dann, wenn man sich von der selbsternannten Hektik der Welt in den Würgegriff genommen fühlt.
Gut möglich, dass das Buch die Lesegemeinde spaltet. In die, die bald beim Lesen abschweifen, an Eigenes denken, aus dem Fenster schauen, selbst aufs Rad steigen und selbst Bier trinken, wenn auch vielleicht nicht in Sichtweite der Donau. Andere aber und es werden nicht wenige sein, werden dieses Buch wie einen kleinen Schatz aufheben und es wird ihnen auf sonderbare Weise nicht gelingen, es ins Regal zu stellen – die übliche Art, ein Buch abzuhaken und zu vergessen. Vielmehr liegt das Buch weiterhin herum, will sich nicht weglegen lassen, nicht zudecken mit anderen Büchern, die man allesamt noch lesen will und vielleicht findet es am Ende ein dauerhaftes Plätzchen auf dem Nachttisch, wo es da und zur Hand ist, wenn einem danach ist, sich seiner eigenen Bedeutung zu versichern oder auch nur um sich mal wieder den Sommer herbei zu lesen.
(Frank Keil-Behrens, Rezension im TITEL kulturmagazin vom 25. Juli 2005)
Angelika Zimmermann: Judith Pouget: sprechen, um zu berühren.
Judith Pouget beschreibt in ihrem Text „Sprechen, um zu berühren“, der mit „Briefjournal eines Sommers“ untertitelt ist, die Beziehung einer Ich-Erzählerin zu einem abwesenden Geliebten. In fiktiven Briefen an diesen versucht sie, sich über die Gefühle, die die Begegnung in ihr ausgelöst hat, Klarheit zu verschaffen – „all der emotionale Aufruhr, kaum schlafen, kaum essen, so viel Veränderung“. Sie versucht sich die Vergangenheit in Erinnerung zu rufen und entwirft Perspektiven für eine gemeinsame Zukunft.
Daneben befinden sich Beschreibungen des Alltags der Erzählerin, den diese ihrem Du mitteilen und für es bewahren will – die Sommernachmittage an einem Linzer Badesee, den Ausflug ins Burgenland zu einer Freundin, das Schreiben, die Lektüre sowie ausgiebige Schilderungen des Wetters und dessen Auswirkungen: „Nach viel Regen ist es immer noch heiß und wir haben fast hundert Prozent Luftfeuchtigkeit – ein Wetter, bei dem ich leicht depressiv werde; nicht von der Hitze, sondern von dieser drückenden, lastenden Schwüle, die sich wie ein eisener Ring um den Kopf legt, mich unfähig macht, klar zu denken.“
Vom angesprochenen Du erfährt man lediglich, dass es abwesend ist – auf einer Reise, aber man erfährt kein eindeutiges Motiv für die Abwesenheit, und selbst während einer kurzen Anwesenheit, die die Erzählerin in nur wenigen Zeilen beschreibt, bleibt dieses Du sprach- und konturlos, hinter dem ich zurück: „Mein Lieber – endlich bist du zurück. Ich war so froh gestern, Dich zu sehen; mit Dir in der Küche zu sitzen, während dieses heftige Gewitter niederging, Dich anzusehen, Deine Füße auf meinen zu spüren und dann neben Dir einzuschlafen, zum Geräusch des Regens, umarmt und friedlich. Du hast dich bedankt für die Nähe – ich danke Dir auch.“ Das einzige, das der Leser über dieses Du erfährt, ist, dass es ebenso wie die Erzählerin selbst schreibt – davon, dass die Erzählerin während seiner Abwesenheit Bücher von ihm liest, die sie an die Gespräche mit ihm erinnern, ist die Rede.
Es ist ein Kommunizieren über die Schrift, das in diesem Text beschrieben wird, der Versuch die Ferne mittels der Schrift zu überwinden, durch die Schrift etwas wie Nähe zu erzeugen, was auch der Titel nahe legt. Als Leserin fühlte ich mich jedoch gerade durch diese Intimität, die immer wieder ins Klischeehafte abrutscht, ausgeschlossen – zu deutlich schienen mir die Briefe an ein bestimmtes Du adressiert und zu sehr konzentriert auf das erzählende ich. Dies mag freilich mit der Tagebuchform zusammenhängen, in die die Briefe eingebettet sind. Doch auch ein Text dieser Form sollte sich dem Leser gegenüber nicht völlig verschließen. Ich fand es jedenfalls irritirend, dass diese Briefe nicht an mich adressiert zu sein schienen und mir nichts zu sagen hatten. Natürlich ist die Öffnung der Kunst gegenüber dem Alltag begrüßenswert, allerdings sollte die Kunst dabei nicht hinter dem Alltag verschwinden, die Abbildung des Alltags nicht Selbstzweck sein. Als Person außerhalb der beschrieben Zweierbeziehung bin ich nicht am Alltag der Erzählerin interessiert, sondern am Blick auf den Alltag, an dessen Wahrnehmung. Ich erwarte von einem Text, dass er meinen Blick schärft, meine Perspektive auf etwas verändert, mir eventuell Bekanntes zeigt, aber anders.
Unterhaltsam ist der Text vielleicht für Bewohner von Linz und Umgebung, die mit den zahlreichen Orts- und Örtlichkeitsbezeichnungen tatsächlich konkrete Orte verbinden. Ein mit dieser Umgebung nicht so vertrauter Leser weiß jedoch mit regional beschränkten Hinweisen wie „von der Webschule an sind die Häuser am Kai und in der Ottensheimer Straße nur noch mit Booten zu erreichen“, „Steyregger Brücke“ oder „Goldwörthersee“ eher wenig anzufangen. Der Text endet mit dem Vorsatz zum Aufbruch. Meinem Empfinden nach kommt dieser Aufbruch jedoch zu spät.
(Angelika Zimmermann, Rezension im Buchmagazin des Literaturhaus Wien, 11. Mai 2005)
http://www.literaturhaus.at/index.php?id=2317&L=0
