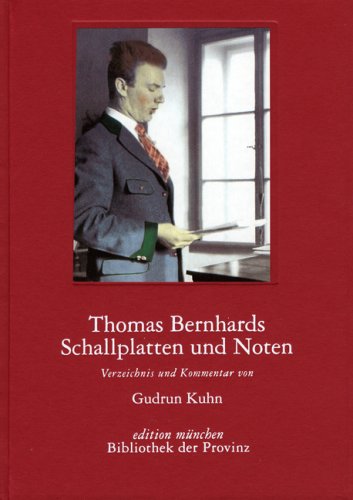
Thomas Bernhards Schallplatten und Noten
Verzeichnis und Kommentar
Gudrun Kuhn, Thomas Bernhard
edition münchenISBN: 978-3-901862-06-9
17×12 cm, 62 Seiten, Hardcover
10,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Kurzbeschreibung
Wie kann ich auch nur einen Augenblick daran denken, mich zu beruhigen, dachte ich, wenn alles in mir so voller Aufregung ist? Und ich versuchte es mit einer Schallplatte, mein Haus hat die beste Akustik, die sich denken läßt und ich füllte es an mit der Haffnersymphonie. Ich setzte mich und machte die Augen zu. Was wäre alles ohne die Musik, ohne Mozart? Immer wieder ist es die Musik, die mich rettet. Indem ich mir immer wieder selbst mit geschlossenen Augen das mathematische Rätsel der Haffnersymphonie löste, was mir immer das größte aller Vergnügen gemacht hat, beruhigte ich mich tatsächlich.
BETON
Wer sich auf die Bernhard-Pilger-Reise begibt, wünscht sich insgeheim dies: zu Fuß durch den Haselwald müsse man doch – gleich beim ersten Blick auf den Nathaler Hof – schon einige Töne von weitem herüberhören. Einen Mozart bitte. Einen Strauß bitte. Einen Beethoven bitte …
Gedenken an Paul Wittgenstein, der, wenn das Wetter danach war, allein im Hof sitzend, die Augen geschlossen, eine im ersten Stock abgespielte Schallplatte genoß, die bei weitgeöffneten Fenstern vom Hof unten auf das vorzüglichste anzuhören war.
Keine fiktionale Selbstinszenierung des Autors, wenn er sein Ich hier sagen läßt: Wir hörten stundenlang zusammen Mozartmusik, Beethovenmusik, ohne auch nur ein Wort zu sprechen. Das liebten wir beide. Die Nachbarn können noch heute ein Lied davon singen – wie gesagt wird.
Ein Plattenspieler in jedem Stockwerk. Wir kennen diesen (oder das Transistorradio) als notorische Requisite aus vielen Theaterstücken. Wenn nicht wenigstens eine der Figuren Klavier spielt (eine Mozartsonate, eine Beethovenvariation, Schumanns Fantasie op.17), drehen sie an den Geräten: Haffnersymphonie, Forellenquintett, Beethovens Fünfte … Eine Plattenhülle auf dem Tischchen im unteren Stockwerk des Nathaler Hauses ist leer: Johannes Brahms, die vierte Symphonie. Die Platte liegt noch auf dem Teller. Wann war sie zuletzt abgespielt worden?
Über dreißigmal kehrt das Thema in der Chaconne des vierten Satzes wieder, ein später Höhepunkt traditioneller Formkunst. Wittgenstein hatte vor allem dies an Brahms bewundert und geliebt: die Variation als mathematische Operation, die ihre Regel in sich trägt. Und Bernhard? Inspirierte ihn solche Musik zu seinem immer wieder als musikalisch apostrophierten Wiederholungs-Stil? …
Rezensionen
Hermann Schlösser: Dichterische Fake-NewsIm deutschen Sender SWR 3 lief im Jahr 2001 die kleine Serie „Lauter schwierige Patienten“. Heute ist sie auf „Mierendorffs Kanal für Reich-Ranicki“ via YouTube zu empfangen, und sie ist nach wie vor interessant. Peter Voß, der Intendant des Senders, unterhielt sich mit Marcel Reich-Ranicki über die Klassiker der zeitgenössischen Literatur: Bertolt Brecht, Anna Seghers, Max Frisch, Ingeborg Bachmann usw.
Der damals achtzigjährige Literaturkritiker sprach über diese toten Dichter und Dichterinnen als überlebender Zeitzeuge, der seine „Patienten“ noch persönlich gekannt hat. Doch er lieferte nicht nur lustige Anekdoten, sondern auch eine kritische Einordnung. Gestenreich, wortgewaltig und urteilsfreudig verteilte er höchstes Lob und vernichtenden Tadel. Dazwischen gab es nicht viel.
Diese Entschiedenheit war die Stärke Reich-Ranickis, der 2013 im hohen Alter gestorben ist. Sie war aber zugleich auch sein Defizit. Denn alles, was von seiner Urteilsmaschinerie nicht erfasst werden konnte, blieb ihm unverständlich. (Das kennt man auch von anderen Exemplaren der Spezies Mensch.)
Eine der Sendungen war Thomas Bernhard gewidmet, der von Reich-Ranicki hoch geschätzt wurde. Bernhard, so dozierte er, sei ein unglücklicher Mensch gewesen, dessen Lungenerkrankung schon in jungen Jahren zu Impotenz geführt habe. Diese Liebesunfähigkeit habe er in eine faszinierende Literatur der Weltverachtung verwandelt.
Reich-Ranicki berichtete auch von einem Interview, das er mit Bernhard geführt hatte. Ein Tonband sei mitgelaufen, aber er, Reich-Ranicki, habe das Band später vernichtet, weil er den Dichter nicht bloßstellen wollte. Die Bloßstellung holte er nun postum nach und behauptete, Bernhard habe eine unfassbare Unbildung bewiesen. Von Literatur habe er gar nichts gewusst, von Musik wenig. Robert Schumann habe er nicht einmal dem Namen nach gekannt.
Peter Voß gab zu bedenken, Bernhard habe vielleicht „nur so getan“, als ob er Schumann nicht kenne. Aber diese Möglichkeit hielt Reich-Ranicki für ganz und gar ausgeschlossen.
Da irrte er sich. Aus dem kleinen, schönen Buch „Thomas Bernhards Schallplatten und Noten“, das Gudrun Kuhn in der „Bibliothek der Provinz“ veröffentlicht hat, geht hervor, dass Bernhard einige Platten mit ausgewählt guten Schumann-Aufnahmen besaß. Außerdem zitiert Kuhn zwei Passagen über den Komponisten aus Bernhards Werk. Eine stammt aus der Erzählung „Ja“, die andere aus „Wittgensteins Neffe“.
Thomas Bernhard wusste also, wer Robert Schumann war. Aber vielleicht machte es ihm Vergnügen, den selbstsicheren „Kritikerpapst“ auf den Arm zu nehmen? Man kann sich die Situation gut vorstellen: Ein Band läuft, Reich-Ranicki fragt inquisitorisch: Wie stehen Sie zu Schumann? Bernhard behauptet leichthin, den Namen habe er noch nie gehört, und der Kritiker fällt ganz unkritisch auf diese Art dichterischer Fake-News herein. Das kommt davon, wenn man Schriftsteller nur als „Patienten“ wahrnimmt, und nicht auch als Spieler und Flunkerer.
(Hermann Schlösser, in der Wiener Zeitung vom 12. August 2017, S. 39)
https://www.tagblatt-wienerzeitung.at/meinung/glossen/910064-Dichterische-Fake-News.html
