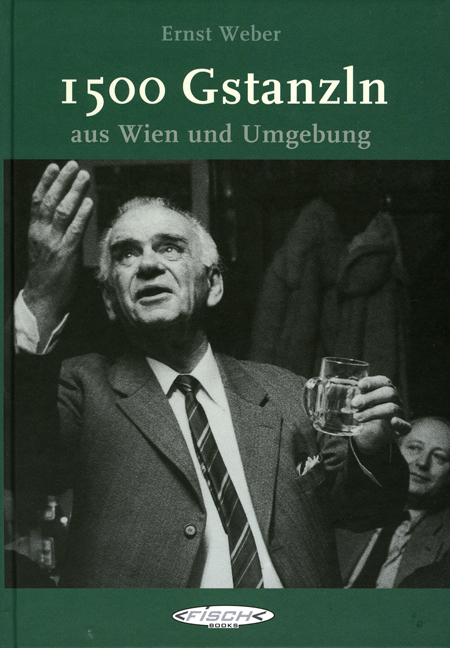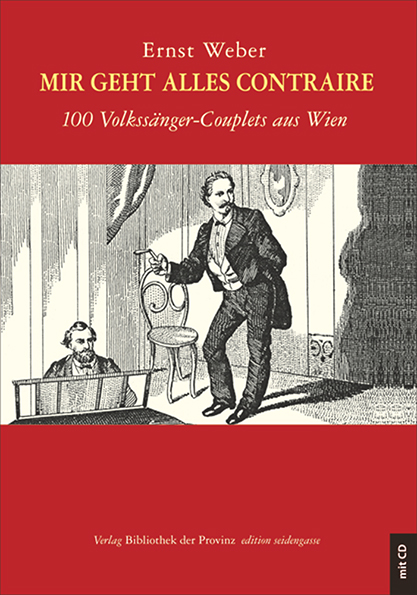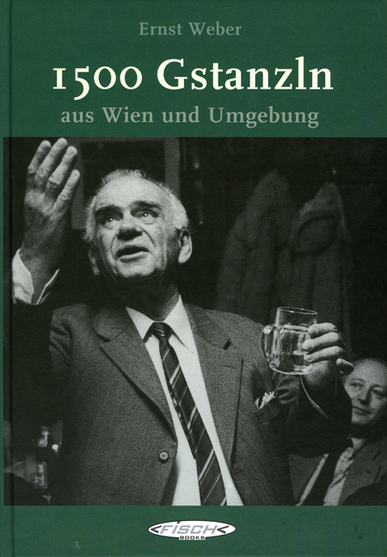
1500 Gstanzln aus Wien und Umgebung
Ernst Weber
ISBN: 978-3-900000-00-4
21 x 15 cm, 366 S. + 1 CD
15,00 €
Momentan nicht lieferbar
Kurzbeschreibung
Auf alten Liedflugblättern, in Liedsammlungen, in den Aufzeichnungen der Volksliedarchive und auf historischen Tonaufnahmen ist die Praxis des Gstanzlsingens in Wien dokumentiert. Aus diesen Quellen hat Ernst Weber eine abwechslungsreiche Sammlung zusammengestellt, die nun als CD und in Buchform erschienen ist.
Die CD dokumentiert in 25 historischen Schellackaufnahmen aus den Jahren 1905 bis 1932 die Gesangsstile der Interpreten der Vergangenheit.
Humorvolle bis besinnliche Vierzeiler aus den verschiedensten Sozialschichten, auf sehr unterschiedlichen Sprachniveaus: vom gepflegten Wienerisch des Bürgertums bis zum Jargon der Wiener Halbwelt, vom urigen Dialekt der Wiener Umgangssprache bis zur ländlichen Mundart am Rande der Stadt und vom „Jiddeln“ der jüdischen Kabarettisten bis zum „Böhmakeln“ der ehemaligen Zuwanderer aus dem Norden.
Ein Blick in die musikalische Vergangenheit der Stadt zeigt, dass neben den Wienerliedern und der Schrammelmusik auch die Gstanzln im Volksmusizieren ihren Platz hatten. Scherz- und Spottgesänge sowie auch kritische Kommentare zu den aktuellen Ereignissen und Lebensumständen gehörten zum ständigen Repertoire der Volkssänger auf den Brettelbühnen, der Gesangskomiker in den Varietétheatern und der Stegreifsänger in den Heurigenensembles der Buschenschänken. Aus dem Umfeld der Stadt, den ehemaligen ländlichen Vororten und den Randgemeinden, stammen unzählige Gstanzlstrophen, die man auch aus dem alpinen Raum kennt, und die jüdische Jargonkomik der Zwischenkriegszeit fand in den Gstanzln ihren besonders originellen Ausdruck.
In Wien bedienten sich die Volkssänger des 19. Jahrhunderts immer schon dieser Form, um ihre humorvollen, spöttischen und auch zeitkritischen Aussagen zu vermitteln. Zunächst waren es die Veranstaltungssäle der Vorstadtwirtshäuser, später dann die Tingel-Tangel-Bühnen, die Vergnügungs-Etablissements, Singspielhallen und Varietétheater, in denen die Volkssänger, die Lokalsängerinnen, Brettlprimadonnen, Gesangskomiker oder Vortragssoubretten ihre Lieder, Duette, Couplets und Gstanzln vortrugen. Die Gstanzln hatten auch in den Volksstücken der Wiener Theaterbühnen ihren traditionellen Platz. Die Volksmusikensembles der Heurigenlokale in den Vororten hatten schließlich neben den instrumentalen Ländlern, Tänzen und Märschen auch sehr publikumswirksame Gesangseinlagen anzubieten. Zu den Duettisten, Jodlern oder Walzersängern gab es meist auch einen Stegreifsänger oder einen Heurigenkomiker, zu dessen Repertoire auch selbst erfundene oder überlieferte Gstanzln zählten.
Die typischen Merkmale der Gstanzln aus Wien
Grundprinzip aller Gstanzln ist die einfache, meist vierzeilige Strophenform. Manchmal genügen bereits zwei Zeilen, um einen Gedanken auszudrücken, in anderen Fällen ist es sinnvoll, eine Strophe auf acht Zeilen auszuweiten. Die Wiener Gstanzln bringen zahlreiche weitere Varianten ins Spiel. Manchmal ist eine fünfte Zeile angeschlossen, dann wieder wird ein einzelnes Wort oder eine kurze Wortgruppe angehängt, oder eine Strophe wird durch Wiederholungen auf sechs Zeilen verlängert. Einschübe von kurzen Jodlerphrasen oder angeschlossene Jodlerteile sind weitere Verlängerungen, die den oftmals verwendeten Begriff „Vierzeiler“ von dem Begriff „Gstanzl“ unterscheiden.
Der Terminus „Gstanzl“ wurde in Wien immer sehr unterschiedlich angewendet. Es ist in Einzelfällen schwierig, die Gstanzlform von anderen Liedtypen abzugrenzen, daher darf es nicht irritieren, wenn manche Lieder, aber auch Liederpotpourris oder Couplets als Gstanzln betitelt sind.
So sind sich Gstanzln und Couplets in ihren Inhalten sehr ähnlich, sie versuchen die Tagesereignisse zu kommentieren, sich über die Schwächen der Mitmenschen lustig zu machen und kritische Standpunkte zu den Missständen ihrer Zeit zu beziehen. Womit die Autoren und Interpreten einen kreativen, eigenständigen Beitrag über die bloße Wiedergabe von überliefertem Material hinaus leisteten.
Die musikalische Grundlage der meisten Gstanzln ist eine Ländlermelodie im 3/4-Takt mit einfachen Basisharmonien. Grundsätzlich würden einige wenige melodische Grundmuster genügen, um fast alle Gstanzlstrophen zu singen. Jedoch haben gerade die Wiener Interpreten immer wieder neue Melodien zu ihren Versen erfunden oder zumindest eigene Varianten zu traditionellen Melodien geschaffen, und auch geradtaktige Formen gehören zu den Standardmelodien Wiener Gstanzln.
Gstanzlauswahl:
In Wien, wie bekannt,
Fressen s Rossfleisch sehr viel,
Und wann s kane Pferd haben,
Fressen s Automobil.
A bluatjunges Ehepaar die gfreun sich schon sehr,
Dass s bald werdn a Wohnung haben, doch das is schwer,
Am Mietamt, da sagn s nur, tan s uns net sekkieren,
Bis s fufzg Jahr verheirat san wern s ane kriagn.
Mei Frau die is sparsam wie kane im Haus,
Mit an Kübel Wasser reibt sie s Zimmer aus,
Das is net die größte Kunst, ham S a Idee,
Dann nimmt sie das Wasser und kocht an Kaffee.
Das Hunderl wird gstreichelt und kost von der Frau,
Kriagt Zuckerl, a Fleischerl, und macht s nur „wau wau“,
Und da sagt mancher Arme, der hungert soeben,
Wie das unlogisch klingt - er hat a Hundelebn.
In Bier und in Wein
Soll da Teifel drin sein,
So lad als s ma tuat,
So a Teifel schmeckt guat.
A Hetz und a Gaude geht uns über alls,
Das was ma verdienen, das rinnt durch den Hals,
Mir gengan erst ham, bis ka Tropfen im Fass,
Und der Hausherr kriagt an Zins - oder was.
Aber so zwa wia mia zwa, die findt ma net bald,
Und mia san a gleich groß und mia san a gleich alt,
Wia die Sternderln am Himmel, die Bleamerl im Gras,
Und so liabn si mir zwa - oder was.
Die Frauen, so heißt es,
Sind das schwache Geschlecht,
Doch bei die Weiber vom Naschmarkt
Da glaubt man s nicht recht.
Und a Schwiegermuada und a Bandlwurm
Habn die gleiche Natur,
Solang s d Schädeln net weg haben,
Gebn s all zwoa ka Ruah.
Der Pfarrer, der predigt,
Die Liab is a Sünd,
Daweil hat sei Köchin
Von eahm a klans Kind.
Und der Pfarrer von Grinzing
Hat so an kloawinzign,
An kloanwinzign Huat,
Aber steh tuat er eahm guat.
Mei Schatz is a Bäck,
Der wohnt net weit weg,
Mitn Salzstangl kummt er,
Mitn Kipfl geht er weg.
Vom Wirten da drübnat der Franz,
Der hat an unbändigen - Hund.
Ja wann i nur a so an hätt,
Der was ma die ganze Nacht - bellt.
Warum is am Land draußt
Die Luft gar so guat,
Weil kana von die Bauern
A Fenster auftuat.
Der oane geht krump
Und der andre geht grad,
Der oane sauft am Land
Und der andre in der Stadt.
Eine Frau sagt, ich hab gestern Nacht
Im Theater mich halbtot gelacht,
Halbtot gelacht, sagt drauf der Mann,
Na, dann schau dir s morgen wieder an.
Wie macht man aus e Kalbsgulasch
Im Handumdrehn ein Rindsgulasch?
Man dreht den Topf mit Kalbsgulasch
Ganz einfach um, dann rinnt s Gulasch.
Herr Kohn sitzt in e Würschtlerei,
Da geht e schönes Mädel vorbei.
Kaum hat der Kohn das Mädel gsehn,
Springt auf er und lasst s Würstel stehn.
Im Seebad schreit Frau Kunigund,
Um Gotteswilln, ich hab kan Grund,
Wenn du kan Grund hast, sagt ihr Mann,
Du blöde Gans, was schreist du dann?
Wann s Taler tat regna
Und Goldstückeln schneibn,
Das war so a Wetter,
Was allweil kunnt bleibn.
Und is s Geld beim Teufel,
Dann sei s in Gottsnam,
Die Hauptsach is,
Dass ma s Leben gnossen habn.