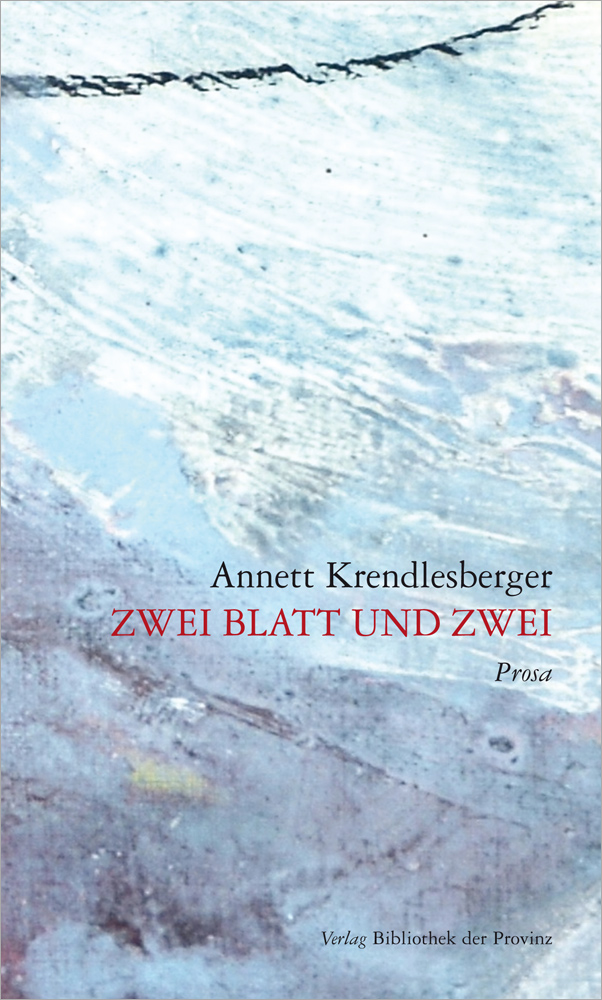
Zwei Blatt und zwei
Prosa
Annett Krendlesberger
ISBN: 978-3-99028-740-8
19 x 12 cm, 144 Seiten, Klappenbroschur
€ 15,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
Er ist ihr so nah wie ein Bruder. Nicht, dass sie ihm das jemals gesagt hätte, und doch scheint ein Gefühl von verletzter Eitelkeit die Freundschaft zwischen ihnen zu belasten.
Als sich Magnus plötzlich verändert und eine Affäre mit ihrer schönen Kollegin beginnt, als seine Solidarität langsam schwindet, der Freund die Freundschaft „verrät“, zweifelt sie an sich selbst.
Und sie flüchtet nach Rom. Dreht sich einfach um, wendet ihm den Rücken zu. Setzt die Sonnenbrille auf. Sonnenbrillen wirken Wunder, Verdunkelungsstrategie gegen allzu grelle Penetranz. Wie Lichtschutzscheiben in der Limousine, als müsste man sie nur hochfahren, die Trennwand, radikal, kompromisslos Nähe unterbinden, jegliche Verbindung, sollte es in diesem Fall so etwas wie eine Verbindung überhaupt gegeben haben …
Sie sitzt am Fenster, beobachtet das Treiben auf der Gasse. Und sie hungert. Kieferknochen schimmern durch Papier. Wie sich einlassen aufs Leben, auf dessen Lachen, Fratzenlachen? Wie berührt man, ohne zu berühren?
Rezensionen
Helmuth Schönauer: [Rezension zu: Annett Krendlesberger, „Zwei Blatt und zwei“]Manchmal ist eine Seele so verletzt und aufgewühlt, dass sie nicht einmal mehr mit einem Roman über die Runden kommt, in so einem Fall hilft nur spitze Prosa.
Annett Krendlesbergers „Zwei Blatt und zwei“ ist natürlich ein Roman, wenn man ihn beim ersten Mal durchstreift, in einem zweiten Nachgang bemerkt man als Leser, dass es gerade jene, Schnitt für Schnitt, zertrennte Seelen-Helix ist, die in zwanzig Prosaanläufen als Thema herausgeschält wird.
Die Heldin erlebt als Ich-Erzählerin eine Kränkung, ihr angebeteter Magnus hat offensichtlich mit einer Kollegin eine Affäre angefangen. Und obwohl das eigene Verhältnis zu ihm noch gar nicht richtig abgeklärt ist, empfindet sie es als Schlag ins Gesicht. Wie immer, wenn eine undefinierte Verletzung die Psyche beeinträchtigt, sieht die Erzählerin in der Folge alles unter dem Aspekt einer Kränkung aus heiterem Himmel heraus.
Die Heldin flieht mit Luftgepäck ausgerüstet nach Rom, bleibt aber an den diversen Reisestationen hängen und verliert sich während einer Taxifahrt, in der Schlange vor dem Sicherheits-Check, in der Luftbestuhlung oder auch nur in einer fehlenden Farbschattierung, wofür das Mausgrau berühmt ist.
Während es im Innern brodelt und die Welt in scharfen Sätzen herantanzt wie bei einem Pfeil-Angriff mit Impulsen, erweisen sich die Menschen rundherum ebenfalls angeschlagen, in Verdruss versunken oder mit nervösem Getue beschäftigt. Innen und außen ist keine Ruhe, und wenn zwei Teile zusammenpassen, liegt schon wieder ein Schatten von Magnus über den soeben abgearbeiteten Gedanken.
Rom selbst ist in Hitzepartikel aufgesplittert, die Wohnung, die Plätze, alles ist heiß, der ewige Ferragosto lähmt das Leben, und selbst der Papagei bringt keine Sätze mehr hervor, sondern nur Exkremente.
Auf der Toilette ist es ein Bild, das die Seelenlage beschreibt. „Im Abwaschbecken sitzt eine Kakerlake. So sehen Kakerlaken aus. / Die Klobrille ist aus Holz. / Die Klobrille ist weiß lackiert. / Zwei Blatt und zwei, zwei und zwei rundherum drapieren. / Ich geb acht, dass ich mir keinen Schiefer einziehe, heb mich vorsichtig auf.“ (90)
Das ist das Geheimnis scharfer Prosa: Sie kann eine große Lage vorantreiben wie ein Roman und kann sich in den Augenblick hineinfräsen wie Lyrik. In dieser mit Sätzen durchgepeitschten Verlorenheit in einer fremden Stadt, in einem fremden Klima, auf einem Ort, der nicht einmal zum Scheißen taugt, imaginiert sich die Erzählerin in die Rolle einer düpierten Prinzessin hinein. Vielleicht ist alles nur Animosität, vielleicht ist alles ganz anders, vielleicht muss man nur die richtigen Wünsche formulieren: Gebt mir ein Schloss! (109)
Gerade weil die einzelnen Sequenzen so klar sind, entsteht daraus wie im Pointilismus eine amorphe Masse, in der Heldinnen verschwinden können. – Eine tolle Geschichte, evoziert durch sorgfältige Erzählkunst.
(Rezension: Helmuth Schönauer, [Gegenwartsliteratur 2736], 23. Mai 2018)
https://lesen.tibs.at/node/6269
Gunther Neumann: Aufgerissene Seelenlandschaften
Annett Krendlesbergers sprachliche Nachtgewitter: der Prosaband „Zwei Blatt und zwei“.
Ferragosto: Mitten im Hochsommer fliegt, ja flieht eine Frau von Wien nach Rom in die leere Wohnung einer italienischen Freundin. „Zwei Blatt und zwei“ – schlicht „Prosa“, nicht Roman genannt – sind verwobene Szenen und wütende Wehklagen über den Verlust einer in bruchstückhaften, scharfkantigen Bildern aufgerollten Beziehung.
Im Dschungel ihrer Wahrnehmungen ergreifen grimmige Gefühle von der Ich-Erzählerin Besitz, und stürzen mit ungebremster Wucht auf den Leser ein. Die Protagonistin nimmt eine rundum akzeptierte Normalität als unerträglichen Wahnsinn wahr, die empfundene Macht von Männern und Ohnmacht von Frauen – und deren manchmal anbiederndes Mitläufertum, von dem sie geradezu körperlich angewidert ist.
Umgekehrt erlebt sie das Gedachte, Befürchtete real. In radikal subjektiven Betrachtungen schont sie nichts und niemanden. Ihre widerborstige Außensicht ist zugleich die Innensicht auf aufgerissene Landschaften einer verletzten Seele, die ihre Bitterkeit weniger aus sich heraus als in sich hinein schreit und den Leser in eine umfassende Beklommenheit zieht. Im sprachlichen Furor geraten andere Figuren notgedrungen grobkörnig.
Zögernd gerät man in den Sog brodelnder, dann eruptiver literarischer Tiraden mit gelungenen Gleichnissen wie „Und schon reißt Dutyfree sein cremiges Maul auf“ oder „Mir zerfließen Eiswürfel im Kragen“. Die Fülle an Bildern, Gedankensplittern, Nominalsätzen, Rückblenden, Zeitsprüngen und Ortswechseln verlangt Konzentration. In provokanter, nicht geglätteter Sprachgewalt mit österreichisch-dialektalen und italienischen Einsprengseln gewährt die Erzählstimme keine Atempause.
Dass in der „Bibliothek der Provinz“ veröffentlichte Literatur gar nicht provinziell ist, beweist der Waldviertler Verlag öfters, zuletzt etwa mit Bodo Hells „Kunstschrift“ oder Isabella Breiers „DesertLotusNest“. Annett Krendlesbergers lodernde „Zwei Blatt und zwei“ sind keine flockig-leichte Sommerlektüre, sondern eine Abfolge von sprachlichen Nachtgewittern, deren Blitze jeden Augenblick neue Bilder aufflammen lassen.
(Gunther Neumann, Rezension in der Wiener Zeitung vom 25. August 2018)
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/literatur/984713_Aufgerissene-Seelenlandschaften.html
Birgit Schwaner: [Rezension zu: Annett Krendlesberger, „Zwei Blatt und zwei“]
Kein Entkommen, nicht mal in Rom.
Annett Krendlesbergers furiose Erzählung „Zwei Blatt und zwei“ ließe sich schnell zusammenfassen: Die Ich-Erzählerin Ursula ist in ihren Arbeitskollegen und „Kumpel“ Magnus verliebt. Noch bevor sie ihm sagen kann, was sie empfindet, erzählt ihr Magnus, dass er sich verliebt hätte: in die – mit schlanker Silhouette und langem Blondhaar ausgestattete – gemeinsame Kollegin Yvonne. In ihrem Elend nimmt Ursula eine Woche Urlaub (auch, um die Verliebten nicht sehen zu müssen) und fliegt auf Rat ihrer Freundin Allegra hin nach Rom. Hier bezieht sie Allegras leerstehende Wohnung und versucht, ihren Liebeskummer und die Kränkung durch Magnus' Zurückweisung zu überwinden. – So weit, so banal. So banal als Fall, so dramatisch als Erfahrung, so zeitlos als Thema. Und so komplex, bei näherer Betrachtung.
Der oder die unglücklich Verliebte: eine Figur, deren Schicksal in der Literatur Tragödien oder Komödien generiert oder, lebensnah, beides zugleich. Proust verglich einmal den Zustand der Verliebtheit mit einer bösen Verzauberung, wie im Märchen: Erwacht man daraus, reibt man sich die Augen, blickt verwundert auf das Subjekt seiner ehemaligen Begierde und versteht nicht mehr, was eine/n daran einst im Innersten so ver-rückte. Auch in „Zwei Blatt und zwei“, das sei vorab verraten, erlöst Annett Krendlesberger ihre Protagonistin zuletzt von dieser „Verzauberung“ – doch bis dahin folgen wir ihr durch mehrere Phasen des Liebeskummers, durch Erstarrung, Wut und Verzweiflung, durch Momente abgrundtiefer Tristesse, Unbehagen und Überdruss und erfahren die ganze Geschichte. Auf rund 140 Seiten, unterteilt in zwanzig kleine Kapitel/Episoden – die teilweise per se als Kurzgeschichten gelesen werden könnten. Wenn es denn leicht wäre, das Buch aus der Hand zu legen.
Die Sprache Krendlesbergers entwickelt hier nämlich (zumindest für Ihre Rezensentin) von der ersten Seite an einen Sog, dass es eine Freude ist: klar im Rhythmus, kein Wort zu viel (elliptische Sätze), eindringlich, plastisch und abwechslungsreich (treffsichere Neologismen, Parodistisches, Märchenhaftes, Einsprengsel aus dem Wienerischen, Italienischen u.a.), oft von expressiver Unmittelbarkeit. Dieser Text rückt seinem Leser nah und fesselt in seiner beklemmenden wie tragikomischen Darstellung eines im Labyrinth seiner Gefühle, Vorurteile und Illusionen herumirrenden und auf die Zumutungen der Welt mit Wörtern einhauenden Menschen – bis zur letzten Seite. Eine Assoziation: Ingmar Bergmann sagte einmal (sinngemäß), er habe sich fürs Filmemachen entschieden, weil das Publikum im dunklen Kinosaal wie im Mutterbauch säße und gezwungen sei, auf die angestrahlte Leinwand zu schauen und auszuhalten, was immer er zeige. Und zu diesem „Aushalten, was immer gezeigt wird“, bringt Annett Krendlesbergers Kunst ihre Leser.
Schon die ersten Worte stimmen, im Stakkato, auf das Dilemma ein – und bauen eine dichte Atmosphäre auf: „Schwarzer Estrich, Metalltische, Sesselrücken, hell und hart kratzt's am Schmelz. Rohziegelwunden klaffen an den Wänden, bis auf den Knochen aufgerissene, schlammfarbene Haut.“ Derart, als versehrten, disparaten Leib beschreibt Ursula das Lokal, in dem sie zu Beginn mit Magnus sitzt, für den derselbe Ort nur „herrlich berlinesk“ ist. Der Leser ahnt bereits: Hier leben zwei in konträren Welten. Und nach einmaligem Umblättern fällt Ursula aus ihrer rosa Wolke, schlägt selbst „hell und hart“ auf dem Boden der Tatsachen auf und steigt, quasi mit ‚aufgerissener Seele‘, ins Taxi, zum Flughafen bitte. Und schon blickt der Leser durch ihre Augen, schwankend zwischen Faszination und Unbehagen angesichts des zwiespältigen Wesens, das sich hier, Satz für Satz, offenbart.
Dass Hauptprotagonistin Uschi nicht unbedingt zur Empathie neigt, zeigt schon das zweite Kapitel, betitelt mit „Vierzig Einhundert“ (nach der Telefonnummer eines Wiener Taxiunternehmens): Hier begleitet der dickliche und, sie beschreibt's genau, proletenhaft gekleidete Taxler Jeff Ursula ins Flughafengebäude und trägt ihren Koffer. Vielleicht ist er nur freundlich – doch Ursula ist er aufgrund seines Äußeren peinlich. Dennoch lässt sie ihn wohl in dem Glauben, er helfe ihr, und erträgt seine Gesellschaft – so lange, bis sie in ihrer Angst um die eigene ‚Fassade‘ glaubt, dass die anderen Fluggäste den ungepflegten Jeff für ihren Mann halten und sich über sie lustig machen: „Da, schau her, Randfiguren!“ (S.19). Lesend verfolgt man eine unselige „Double Bind“-Situation: wie Ursula durch die Unfähigkeit, Jeffs Hilfe abzulehnen, eine Situation herbeiführt, in der sie sich gefangen fühlt. Und wie sie dann, als sie endlich den ihr lästigen Mann verabschiedet, meint, ihn verletzt zu haben und eine Spur „abfälliges Mitleid“ mit ihm zeigt.
Dass man sich lesend in der Haut dieser komplexbeladenen, weder mutigen noch selbstbewussten Person wiederfindet, ist nicht zuletzt der Erzählperspektive des inneren Monologs geschuldet (von der sich Leser am schwersten distanzieren können). Das „Text-Ich“, diese Ursula, ist, wie gesagt – und so sehr man ihren desolaten Zustand versteht –, nicht unbedingt sympathisch. Prinzipiell möchte man sich als Leser/in ja mit diesem Ich, dessen Gedanken man hier erfährt, anfreunden, ihm recht geben. Doch derlei simple Identifikation weiß Annett Krendlesberger meisterinnenhaft zu verhindern: Vor allem durch Ursulas kalt abschätzenden, durch die eigenen, konsum- und leistungsgesellschaftlich bedingten Deformationen geprägten Blick auf andere (wie auf sich selbst) wird man immer wieder aus einer versöhnlichen Stimmung gegenüber dieser Protagonistin gerissen. Uschi, die Cargohosen trägt und von sich sagt, sie habe nie viel vom grassierenden Wettbewerbszwang gehalten, urteilt und verurteilt aufs strengste, rächt sich an ihrer oberflächlichen, einen Menschen vor allem nach Statussymbolen wie Markenkleidung, Figur, Besitz und Beruf bewertenden Umgebung mit der Boshaftigkeit der intellektuell überlegenen Außenseiterin, die – so glaubt sie – nicht ‚dazugehört‘, aber die entsprechenden Codes bestens internalisiert hat und als Waffe einsetzt. Das heißt, sie übernimmt den „oberflächlichen“ Blick der anderen, unter dem sie sich entwertet fühlt (und nie erkannt, anerkannt) und treibt diesen ihrerseits dermaßen auf die Spitze, dass er schon wieder Tiefenschärfe entwickelt. Bis ihre (unterhaltsamen) boshaften Bemerkungen vor allem Ursulas Irrglauben an die genormte „Schönheit“ als Allheilmittel (etwa gegen Einsamkeit) widerspiegeln, sie selbst als Betrogene zeigen. Womit ein unangenehmer Punkt erreicht ist, an dem man sich mit dieser Protagonistin doch verwandt fühlt:
Denn natürlich steht dieser Irrglaube für einen Triumph der Konsumindustrie und damit für eine gesellschaftliche Fehlentwicklung, die auf der Ignoranz gegenüber „eigentlicheren“ Werten im immerhin einzigen Leben beruht. Wie viele Frauen, die der Illusion nachhängen, dass sich für sie was-auch-immer zum Guten und Glücklichen wendete, wären sie nur schlank und schön „genug“, scheint auch Ursula ein Opfer der ewig neuen Hochglanzversprechen der Werbewirtschaft, die es versteht, ihre potentiellen Kundinnen im Zustand einer steten Unzufriedenheit mit sich selbst zu halten. Je unsicherer eine ist, je perfekter eine sein will, desto leichter lässt sie sich verblenden, desto stärker hängt sie am Haken der Diäten-Verkäufer, Kleiderhändler, Kosmetikkonzerne, Friseure etc. etc.: „Und schon reißt Dutyfree sein cremiges Maul auf, ein Maul voll Glitzertand, auf der Zunge, zwischen den ungeheuren Zähnen, überall, im Ungeheuergebiss, blitzt's und blinkt's, einmal da, einmal dort, kommt nur näher, schaut sie euch an, meine Regale, meine Vitrinen […]“ (S. 26).
Krendlesbergers Figur der Uschi ist sich der eigenen Verblendung bewusst, ohne sich befreien zu können. In Rom betritt sie etwa einen Laden, in dem eine Frau den Boden putzt und sich dabei von keinem stören lässt. Ursula beobachtet sie, taxiert ihre Kleidung, und wundert sich, wie es dieser einfachen Frau möglich ist, „Würde“ auszustrahlen (und warum sie nicht servil aufspringt und nach den Wünschen der Touristin fragt). Als ahne sie, dass das eigene Weltbild nichts als eine schillernde Blase sein könnte. Der Text ist durchzogen von Hinweisen wie diesem, die sich, verknüpft mit der Geschichte einer Desillusionierung, als Kritik an der seelischen Unwirtlichkeit des – sehr salopp gesagt – zeitgenössischen, vor allem städtischen Lebensstils lesen lassen. Passend unwirtlich sind auch viele Schauplätze der Erzählung: das modisch-gesichtslose Szenelokal, der Flughafen, ein Wellnesshotel – austauschbare und identitätslose „Nicht Orte“, die laut dem französischen Philosophen Marc Augé mit dem Globalisierungskapitalismus überall gleich aussehen und als „Orte für Ortlose“ nurmehr „Einsamkeit und Gleichförmigkeit“ befördern. Jene Ort, die im Gegensatz hierzu stehen, wie Allegras Wohnung oder auch Rom mit seiner langen Geschichte und dem nur hier zu findenden, goldenen Licht der Antike, zeigen sich desolat: das Wasser im Bad funktioniert so wenig wie die Müllabführ und Ursulas Blick fällt auf einen Bettler vorm DeSpar, einen zerrupften Papagei (hier scheint sie ihre eigene Bedürftigkeit im Spiegel anderer zu erkennen) … Desolat, wie das Leben, möchte man meinen. Demgegenüber es auch nichts nutzt, wenn man „zwei Blatt und zwei“ vom Toilettenpapier abreißt und auf die Klobrille legt …
Die Berührungsangst mit diesem „Desolaten“, mit Armut, Krankheit, kurzum allem Hässlichen im Dasein bzw. mit allem, was der glänzenden Fassade widerspricht, hat Ursula am Ende der Erzählung vielleicht nicht wirklich verloren – wie sollte sie auch, handelt es sich doch um ein gesellschaftliches, zumindest in der sogenannten Mittelschicht weit verbreitetes Phänomen. Doch sie findet eine Möglichkeit, sich selbst zu helfen, bzw. auf Doderistisch: in ihrer „Menschwerdung“ fortzuschreiten. Annett Krendlesberger setzt zur Kenntlichmachung dieser Entwicklung ein Märchenmotiv ein: die, nona, Prinzessin im fleischfarbenen Tüllrock, der – man denke an den dicken Taxler Jeff – ein unförmiger Froschkönig zur Seite gestellt wird (auf den übrigens zu Anfang eine kleine, gläserne Figur im Dutyfree-Shop hinwies). Beide, die Schöne (Illusion) und der Hässliche (Realität) sind gegen Ende wie zu einer Figur verschmolzen; das heißt, zumindest ist der Frosch verschwunden und die Schmetterlinge (Farfalle-Nudeln) essende Prinzessin hat zuvor das „hellrosa Haar“ einer „Perücke, die einer Streunerin gehört“ vom „Pflaster geklaubt“ und hilft ihrem Alter Ego Ursula mit Denkanstößen und Ratschlägen. So dienen Kunst (Transzendierung ins Poetische) und Phantasie Ursula zur Selbsthilfe: Wo es nur um den schönen Schein geht, kann man diesen, zum Selbstschutz, anderen vorspiegeln. Und ganz nebenher erkennen, dass die vermeintliche Neben buhlerin eigentlich auf derselben Seite steht.
Allerdings wäre dieser versöhnliche Schluss nicht nötig gewesen; im Gegenteil, vielleicht hätte gerade ein „offeneres“ Ende dieser bemerkenswerten Erzählung gut getan. Dann würde die enttäuschte Liebe zum großsprecherischen – als Figur eher blassen – Magnus (sic!) nur die Rolle des Auslösers der Rom-Reise und eines den Blick schärfenden Zustands spielen, lägen psychischen Auswirkungen der Wettbewerbsgesellschaft, das existentielle Unbehagen Ursulas noch deutlicher zutage. Dann bliebe: das Gefangensein in Unzulänglichem, die Klarsicht bei nicht loszuwerdender Verblendung als conditio humana unserer Tage. Was aber nichts am Rezensentinnen-Urteil ändert: Ein starker Text, bitte lesen!
(Birgit Schwaner, Rezension im Buchmagazin des Literaturhaus Wien, online erschienen am 28. November 2018)
http://www.literaturhaus.at/index.php?id=12058
Klaus Ebner: [Rezension zu: Annett Krendlesberger, „Zwei Blatt und zwei“]
Gefühlschaos.
Es ist das Chaos der Gefühle, das über die Icherzählerin Ursula hereinbricht: Ihr Kollege Magnus, in den sie wohl insgeheim verliebt ist, beginnt eine Liebesaffäre mit einer gemeinsamen Kollegin. Ursula wird von den eigenen, zwiespältigen Empfindungen überwältigt, nimmt Urlaub und reist nach Rom ab, wo ihr die Wohnung einer Freundin offensteht. Beherrscht werden die einzelnen Stationen der Reise von Ursulas Gedanken, von ihren Überlegungen, die allesamt um Magnus, dessen neue Liebe und Ursulas Gefühle kreisen.
Annett Krendlesberger deklariert ihr Buch als »Prosa«, doch im Grunde bilden die zwanzig Texte die Kapitel eines Romans; daher sollte man diese chronologisch lesen. Geschrieben wurden sie in einer Art innerem Monolog, mit vielen kurzen Sätzen, abgehackt und elliptisch, scharf beobachtend und eindringlich. »Eiswind in der Halle, Gate F. Jeff zieht den Koffer. Er besteht darauf. Mausegrau, mausegrau. Und da, der Fette mit Frau.« (S. 16) Anfänglich mag der Stil gewöhnungsbedürftig sein, doch entwickelt er rasch einen starken Sog und Lesende fühlen sich in die Protagonistin ein, sehen die Personen, die ihren Weg kreuzen, mit ihren Augen, verfolgen ihre Kommentare, die mitunter herablassend wirken, aber auch vor intrinsischer Selbstkritik nicht Halt machen. Die Prosa dieses Buches ist naturgemäß gespickt mit Umgangssprachlichem, ebenso wie mit wienerischen Ausdrücken und italienischen Satzfetzen. »Che tempo fa oggi? Wolkenlos und heiter …« (S. 114). Die unterschiedlichen Sprachregister und der unmittelbare, direkte Schreibstil bewirken ein authentisches Miterleben.
Die 1967 in Wien geborene und lebende Autorin studierte Philosophie, Theaterwissenschaft und Betriebswirtschaft. Eine interessante Kombination, die, zusammen mit ihrer Berufserfahrung Krendlesbergers Literatur auf angenehme Weise bereichert.
Das Buch »Zwei Blatt und zwei« ist jedenfalls eine lohnende Lektüre.
(Klaus Ebner, Rezension in der Literaturzeitschrift Etcetera Nr. 75, erschienen am 28. Februar 2019)
https://www.litges.at/kritik/buch/klaus-ebner/annett-krendlesberger-zwei-blatt-und-zwei
Andreas Tiefenbacher: Prosa in „offenbar maßgeschneiderter“ Sprachmontur
Dass Taxifahrer Jeff sie bis zum Check-in-Schalter des Wiener Flughafens begleitet wie der „dicke Kumpel aus der Schule, den man nicht und nicht los wird“, empfindet Ursula als eher unangenehm, weshalb sie (ganz der „Verdunkelungsstrategie gegen allzu grelle Penetranz“ vertrauend) mit Sonnebrille-Aufsetzen und Rücken-Zuwenden reagiert. Schließlich befindet sie sich gerade in keinem Gefühlshoch.
Der Grund ist Arbeitskollege Magnus, der ihre Natürlichkeit „erfrischend“ findet und so tut, als würde sie „sein Star“ sein, ihr bei Bier und Pommes dann aber gesteht, sich in jemand anderen verliebt zu haben.
Das treibt ihr Wasser in die Augen. Doch zieht sie statt des erhofften Taschentuchs einen Pfefferspray aus der Tasche, den sie aber nicht einsetzt. Schließlich ist zwischen Magnus und ihr außer „ein bisschen Geplänkel“ ja nichts gewesen; er eben nur „ein guter Freund“, den sie verstehen kann, wenn er (wie jeder richtige Mann) „auf richtige Frauen steht, auf junge, zarte, die mit langen Haaren eben, nicht auf den Kumpeltyp, den Kurzhaarfreak, nein, auf solche, die zu ihm aufschauen“.
Die 29jährige Journalistin, Schriftstellerin und Teilzeitkraft ohne abgeschlossene Ausbildung benötigt so einen Beschützer aber eigentlich gar nicht. Sie hat sowieso immer Notfalltropfen und Pfefferspray dabei. Außerdem ist der vom Universum geborgte Körper nur „ein Seelenkleid für begrenzte Zeit“ und Selbstmitleid (egal wie stark das Bedürfnis nach Nähe und Bestätigung oder die Zwänge der Leistungsgesellschaft auf‘s Gemüt drücken) keine passende Strategie, wenn man gegen Kränkungen kämpft und großes „Grau“ und sich vorkommt wie eine Laborratte „in einer steilen Röhre“.
Die Flucht nach Rom passt daher genau, um sich all dem blöden „Graffl“ zu entziehen, denn die wunderbare italienische Atmosphäre ist „bombastisch“, der Kühlschrank in der Wohnung der Freundin jedoch leer (il frigorifero è vuoto). Außerdem hat es 45 Grad. Im Schlafzimmer gibt es aber bloß einen kleinen Ventilator. Wegen der Ratten kann man in der Nacht kein Fenster öffnen, hört allerdings trotzdem ständig Menschen plärren, Hunde kläffen, Autos hupen. Und genau unter dem Fenster hocken „bei abwechselnd laufenden Motoren“ ein paar Typen auf ihren Vespas und brüllen die halbe Nacht herum oder fahren auf und ab, während sie bis 4 Uhr früh nicht einschlafen kann.
Darüber hinaus muss Ursula aufgrund des Wassermangels mit Mineralwasser aus dem Küchenvorrat per Papiertaschentuch vorsichtig Gesicht, Hals und Dekolletee abtupfen, „mit fetten Fingerabdrücken, Saft, Spucke?, komplett übersäte“ Bankomaten benutzen und mit dem Schöpflöffel auch noch eine Kakerlake erschlagen.
„Die wunderbare Aussicht“ entschädigt sie glücklicherweise dafür, während das ganze „sich vor dem vergoldeten Spiegel drehen“ nicht hilft, um an sich selbst („müfflich, schlaffbäuchig“) Schönes zu entdecken. „Selbstliebe“ ist überhaupt ein Wort, das sie hasst. Dementsprechend achtet Ursula streng darauf, dass sie nicht „etwas Unbekanntes erfasst wie Leichtigkeit oder Unbeschwertheit oder Lebensfreude und sie es noch umhaut vor Glück“.
Im Grunde gibt es nichts, was sie zum Leben „unbedingt haben muss“. Es reicht, dass sie Magnus nicht sieht, wie er mit einer anderen im Büro herumturtelt, und sie sich mit dem Geschmack der crostata (Mürbteigkuchen) beschäftigen kann, wegen dem sie eigentlich nach Rom gekommen ist.
Wie deren Teiggitter verhindert, dass die gute römische marmellata bei 50 Grad im Schaufenster „einfach so wegfließt“, verhindert Annett Krendlesberger durch ihren extravaganten, dynamischen, mit dialektalen Redesequenzen, italienischen Einsprengseln und allerlei anderen Impulsen aufgeladenen Erzählstil, dass Ursulas Reise bis „in die hintersten Winkel der grindigsten Seitengassen“ Roms nicht zu einem fulminanten Lesevergnügen avanciert.
Ihr Prosa-Unternehmen ist kühn. Es imitiert ‚Sprech‘, hinterfragt Haltung, bohrt in der Spezifik sozialer Gruppen, raut Italien-Klischees auf, bleibt aber selbst in der kompliziertesten ideellen Ausführung und Metaphorik prickelnd witzig.
Annett Krendlesberger entfaltet in „Zwei Blatt und zwei“, dessen Titel das Drapieren des Klopapiers auf der Klobrille bezeichnet („zwei Blatt und zwei, zwei und zwei rundherum“), ein sensibles Sprach- und Kommunikationsfuriosum, das am normalen Handeln vorbei in die Tiefen der Beschreibungsvielfalt vorstößt. Dabei entwickelt sich eine Prosa in „offenbar maßgeschneiderter“ Sprachmontur, „die die Welt auf eine ganz bestimmte Weise sieht, in allen Farben“. Besser geht es kaum!
(Andreas Tiefenbacher, Rezension in der Bücherschau, online veröffentlicht am 15. November 2019)
https://www.buecherschau.at/cms/V03/V03_0.a/1342620507012/home/krendlesberger-annett-zwei-blatt-und-zwei
