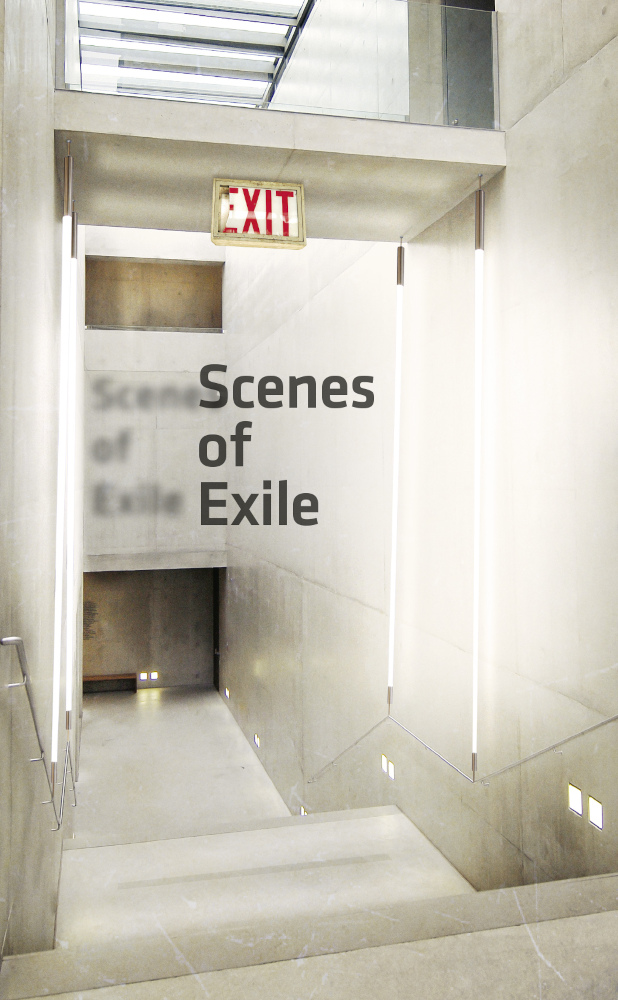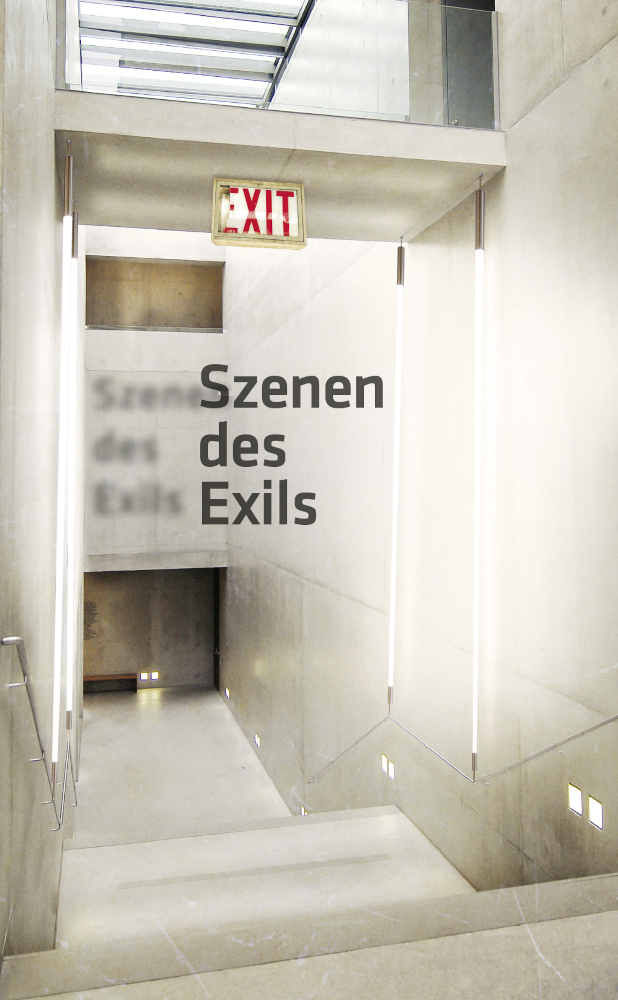
Szenen des Exils
Thorsten Sadowsky, [Hrsg.] Museum der Moderne Salzburg
ISBN: 978-3-99028-946-4
21 x 13 cm, 316 Seiten, zahlr. vierfärb. Abb., Softcover
29,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
[Diese Publikation erscheint anlässlich der Abschlussausstellung der dreiteiligen Reihe zu Künstler_innen mit Exilhintergrund Orte des Exils, 25. Juli – 22. November 2020, Museum der Moderne Salzburg.
Hrsg. von Thorsten Sadowsky für das Museum der Moderne Salzburg.
Texte von Ute Eskildsen, Barbara Herzog, Kurt Kaindl, Elke-Vera Kotowski, Christiane Kuhlmann, Brigitte Mayr und Michael Omasta, Walter Moser, Andreas Neufert, Frank-Manuel Peter, Astrid Schmetterling, Thorsten Sadowsky, Peter Schreiner, Georg Schrom, Rosa von der Schulenburg, Tom Waibl und Elisabeth Streit, Magdalena Vuković, Andrea Winklbauer.]
[artedition | Verlag Bibliothek der Provinz]
Die vorliegende Publikation führt die drei Ausstellungen Auf/Bruch. Vier Künstlerinnen im Exil (2017), Resonanz von Exil (2018) und Orte des Exils (2020) zusammen. Mit diesem profunden Beitrag zur Exilforschung verbindet sich der Anspruch der Erinnerungsarbeit, indem mit der Aufarbeitung einzelner Lebensgeschichten auch die Werke und Ideen der verfolgten und vertriebenen Künstler_innen umfassend gewürdigt und vor dem Vergessen bewahrt werden.
„Nicht nur muss man sich anpassen an etwas Neues, sondern man muss auch noch versuchen, irgendwie zu verstehen, was da überhaupt geschehen ist und wie man damit umgeht. Das ganze Leben geht vorbei und man versteht's noch immer nicht.“ (Amos Vogel)
Rezensionen
Wilbert Ubbens: [Rezension zu: Thorsten Sadowsky/Museum der Moderne Salzburg (Hrsg.), „Szenen des Exils“]Sadowsky, Direktor des Museums der Moderne Salzburg, benennt im Vorwort des Katalogbandes Exil als die zentrale Erfahrung der Moderne und der Postmoderne und somit als Pflichtprogramm für ein Museum, das den Begriff Moderne im Namen führt (S. 7). Noch ein zweites Motiv komme hinzu, basiert das Museum, die frühere Landesgalerie im Rupertinum, doch zu großen Teilen auf Schenkungen des Kunsthändlers Friedrich Welz (von 1977 bis 1980 auch erster Leiter der Landesgalerie), der im nationalsozialistischen Österreich in Salzburg durch An- und Verkäufe von Kunstwerken auch aus dem Besitz jüdischer Österreicher zu diesem Reichtum gekommen war, – ein Versatzstück aus dem Komplex von Ausraubung, Vertreibung und schließlich beabsichtigter Vernichtung der jüdischen Mitbürger in Deutschland und Österreich.1 2017 hat Sabine Breitwieser, die Vorgängerin Sadowskys, eine Ausstellungsreihe zum Thema jüdisches künstlerisches Exil während des Nationalsozialismus’ initiiert, deren erster Teil Auf/Bruch. Vier Künstlerinnen im Exil 2017 gezeigt worden ist, dem folgten 2018 Resonanz im Exil und 2020 Orte des Exils, – zu den drei Ausstellungen ist ein gemeinsamer Katalogband erschienen, der hier kurz vorgestellt werden soll.
Der kleine, wenig prätentiöse Band vereint in einem ersten Teil kurze Textbeiträge zu den Ausstellungen und zu den in den Ausstellungen jeweils präsentierten, insgesamt 16 Künstlerinnen und Künstlern, danach folgen ohne Bezug auf die Einzelausstellungen die Abbildungen der präsentierten Kunstwerke, gegliedert in die Abschnitte Vor dem Exil, Im Exil und Nach dem Exil,2 zusammengestellt mit Unterstützung von 58 Leihgebern und aus eigenen Beständen. Die einführenden Texte zu den Ausstellungen und zu den einzelnen Künstlerinnen und Künstlern stammen von den Kuratorinnen, für die biographischen Essays sind externe Fachleute eingeworben worden, die im Anhang kurz vorgestellt werden. Dort und in den Anmerkungen finden sich auch weiterführende Literaturhinweise, das Impressum ist nach Art eines Filmabspanns sehr ausführlich ausgefallen.
Die erste Ausstellung Auf/Bruch. Vier Künstlerinnen im Exil will schon mit ihrem Titel auf die Härte der erzwungenen Entscheidung zur Flucht ins Exil hinweisen. Die vier präsentierten jüdisch-geborenen Künstlerinnen gelten den Ausstellungsmacherinnen als Repräsentantinnen der ersten berufstätigen Generation von Künstlerinnen in Deutschland und Österreich, – ihre Berufskarrieren wurden durch die Nationalsozialisten verhindert, durch das erzwungene Exil zerbrochen und in ungewollte Bahnen gelenkt: Die Fotografinnen Ellen Auerbach (1906–2004) und Grete Stern (1904–1999) führten vor ihrer Flucht 1933 gemeinsam das Studio für Werbefotografie ringl+pit in Berlin, im Exil wurden sie getrennt: Ellen Auerbach floh über London nach Tel Aviv und schließlich New York, sie gab die Fotografie auf und lebte ab 1944 als Pädagogin in New York. Grete Stern arbeitete seit 1935 in Buenos Aires weiter als Fotografin, jetzt zu psychologischen und gesellschaftlichen Problemen von Frauen. Nach ihrer Ausbildung am Bauhaus war Friedl Dikker-Brandeis (1898–1942) früh als vielseitige Künstlerin im Bereich Schmuck, Stoffe, Graphik und Design in Berlin und Wien tätig, 1934 mußte sie als Kommunistin nach Prag ausweichen und lebte dort versteckt auf dem Land. 1942 nach Theresienstadt deportiert, wirkte sie dort noch als Kunstpädagogin, 1944 wurde sie in Auschwitz ermordet. Die Fotografin Elly Niebuhr (1914–2013) erlebte nach vielseitiger Ausbildung erste Erfolge als Reportagefotografin in Wien, bevor sie 1939 nach England und weiter in die USA ins Exil fliehen mußte, sie arbeitete dort in verschiedenen Berufen und kehrte 1948 nach Wien zurück, erst 1958 begann ihre Karriere als Modefotografin, zur Reportage fand sie nicht zurück.
In der zweiten Ausstellung Resonanz von Exil gehen die Ausstellungsmacherinnen am Beispiel von sechs Künstler/innen und ihren individuellen Schicksalen stärker auf das erzwungene neue Leben im Exil ein. Die künstlerisch ausgebildete Ausdruckstänzerin Valeska Gert (1892–1978) emigrierte 1936 nach England und 1939 weiter in die USA, in New York eröffnete sie einige Bars und Lokale, in denen sie auch tanzte. Seit ihrer Rückkehr 1948 nach Europa hoffte sie vergeblich auf eine neue Avantgarde und führte schließlich ein Lokal auf Sylt. Zunächst Musikerin, erlernte Lisette Model (1901–1983) nach 1926 schon in Frankreich das Fotografieren und setzte nach 1938 in New York ihre Karriere als sozialkritische Fotografin fort, von 1949/1951 bis 1971 lehrte sie in den USA künstlerische Fotografie. Dora Kallmus (1881–1963), genannt Madame d’Ora, führte bis 1927 in Wien das fotografische Atelier d’Ora und war danach in Paris als Modefotografin erfolgreich, die deutsche Besetzung überlebte sie in einem südfranzösischem Dorf, nach ihrer Rückkehr wandte sie sich 1948 in Wien sozialkritischer Fotografie zu. Wolfgang Paalen (1905–1959) etablierte sich in den 1930er Jahren in Paris als surrealistischer Maler, 1942 bis 1945 beeinflußte er mit seiner Zeitschrift DYN die abstrakte Kunst von seinem Exil in Mexiko aus, wo er bis zu seinem Tod als Maler tätig war. Die in Wien geborene Grafikerin Lili Réthi (1894–1969) wandte sich zeitlebens Motiven der Industriewelt zu, schon in den 1920er Jahren in Deutschland, danach in Dänemark und England, wohin sie 1938 emigrierte, in ihrem späteren Exil in den USA war sie als Buchillustratorin erfolgreich. Amos Vogel (1921–2012) mußte als Jude 1938 vor dem Schulabschluß Wien mit seinen Eltern verlassen und blieb ohne berufliche Ausbildung. In den USA leitete er von 1947 bis 1963 mit großem Erfolg einen avantgardistischen Filmklub und engagierte sich danach als Autor und Kurator in Ausstellungen und Festivals für den künstlerischen Film.
Die dritte Ausstellung Orte des Exils stellt die vielfach nur vorübergehenden und weltweit verstreuten Aufenthaltsplätze einiger bildender Künstlerinnen und Künstler in den Mittelpunkt. Der Malerin Lotte Laserstein (1898–1993) blieb nach ersten Erfolgen in Berlin nur die karge Existenz als Kunstlehrerin an einer jüdischen Privatschule, bis sie 1937 nach Schweden eingeladen wurde, dort als Porträt- und Freilichtmalerin arbeitete, aber erst durch eine Scheinheirat Bleiberecht erhielt. Die Lyrikerin und Zeichnerin Else Lasker-Schüler (1869–1945) floh 1933 nur bis in die Schweiz, weil sie ihrer Sprache nahe bleiben wollte; nach mehreren Reisen nach Palästina mußte sie dort ab 1939 wegen des Verbots einer Wiedereinreise in die Schweiz ungewollt bleiben. Louise Kolm-Fleck (1873–1950) wuchs in den Beruf einer Filmregisseurin hinein, bis 1937 drehte und produzierte sie an die 40 Filme in Berlin und Österreich, erst 1940 gelangen ihr und ihrem Gatten die Ausreise in die internationale Zone von Schanghai,3 wo sie ebenfalls einen Film produzierten, 1947 kamen beide wieder nach Wien. Victor Papanek (1923–1998) floh 1938 mit seiner Mutter aus Wien über Holland in die USA, studierte dort Architektur und Design und wurde als Universitätslehrer und Design-Kritiker u.a. mit Entwürfen für Möbel berühmt. Walter Trier (1890–1951) war bereits seit 1909 als satirischer Zeichner und Buchillustrator bekannt, zu Ende der zwanziger Jahre vor allem wegen der Bücher von Erich Kästner, 1933 ging er mit seiner Familie nach London und später nach Kanada ins Exil, wo er weiter rastlos als politischer Zeichner und Werbegrafiker tätig blieb. Der Wiener Wolfgang Suschitzky (1912–2016) engagierte sich als sozialkritischer Fotograf seit 1935 und seit 1937 parallel auch als Filmkameramann in London, von dort aus arbeitete er bis in 1990er Jahre hinein weltweit für zahlreiche illustrierte Zeitschriften, – 2018 kehrte sein fotografisches Archiv zurück nach Wien.
Den Textbeiträgen folgen in anderer Gliederung fast unterbrechungslos 180 Seiten mit fotografischen Abbildungen und Reprographien: 58 Seiten Vor dem Exil, 70 Seiten Im Exil und 40 Seiten Nach dem Exil, an- und durcheinandergereiht in je geänderter Folge in Bilder-„Clustern“ der Künstlerinnen und Künstler, versehen mit sorgfältigen Bildlegenden (die Formate der Vorlagen werden nicht immer angegeben), aber ohne weitere optischen Hilfen und ohne Indexierung. Dies Gliederungskonzept erlaube es, visuelle Querbezüge herzustellen und wiederkehrende Motive und ähnliche Fragestellungen im Schaffen der Exilkünstlerinnen und -künstler sichtbar zu machen, schreiben die Kuratorinnen Barbara Herzog und Christiane Kuhlmann (S. 10): Sie laden zur vergleichenden Betrachtung von Kunstwerken ein, entstanden in existentiell verschiedenen Lebenssituationen vor, im und nach dem Exil. Für interpretationsfreudige Betrachter mag das vielleicht eine Versuchung sein, geholfen hätte in jedem Fall eine deutlichere Zuordnung der Bilder zu den jeweiligen Künstlerinnen und Künstlern, denn zu individuell sind die Schicksale der 16 Betroffenen und kunsttheoretisch zu fragwürdig und gewagt erscheint es, solch generelle Einflüsse an Kunstwerken festmachen zu wollen, – der Spekulation sind keine Grenzen gesetzt. Da Personenregister zu den Abbildungen wie zu den Begleittexten fehlen, bleiben nur Wiedererkennen oder mühsames Studium der Bildlegenden, – mühsam deshalb, weil die geringe Typengröße der Bildlegenden und aller Anmerkungen und Zusatztexte ihre Lektüre ohne Lupe (jedenfalls für den Rezensenten) nahezu unmöglich macht. Auch die Typengröße im Fließtext ist schon knapp bemessen, und zusätzlich erschwert der grauflache Druck auf leicht getöntem Papier jegliche Entzifferung. Zur Qualität der je nach Vorlage farbigen oder schwarzweißen Abbildungen sei festgehalten, daß sie den Vorlagen entsprechend unterschiedlich, aber zufriedenstellend ausfällt. Ihre Größe variiert vom in der Mehrzahl ganzseitigen Format (etwa 10 x 13 cm) zu halb- und viertelseitigen, gelegentlich auch doppelseitigen Formaten. In den Band eingestreut sind Fotografien von Ansichten und Details der Ausstellungen in den schlichten Räumen des Museums.
Was bleibt, ist die Freude über ein umfängliches Bilderbuch mit Werken einiger bekannter und weniger bekannter Künstlerinnen und Künstler, die von den Nationalsozialisten wegen ihrer Herkunft und wegen ihrer politischen Überzeugungen existentiell bedroht, ins Exil geflohen sind. Angereichert ist der Band mit informativen und lesenswerten biografischen Beiträgen, deren Lektüre aber durch Buchgestaltung und Typographie unnötig erschwert wird. Darf man auf die Fortsetzung der Serie und großformatigere Katalogbände hoffen?
1 Zwei Bilder wurden 2011 und 2016 an die Erben der ehemaligen Besitzer restituiert.
2 Inhaltsverzeichnis: https://d-nb.info/1213826942/04
3 Vgl. Exil Shanghai : 1938–1947 ; jüdisches Leben in der Emigration ; [mit Erstveröffentlichung von 14800 Eintragungen der Ausländerliste der japanischen Fremdenpolizei auf CD-ROM] / Georg Armbrüster … (Hrsg.). – 1. Aufl. – Teetz : Hentrich & Hentrich, 2000. – 272 S. : Ill. + 1 CD-ROM. – (Schriftenreihe des Aktiven Museums Berlin). – ISBN 3-933471-19-2 : DM 88.00 [6351]. – Rez.: IFB 01-2-456 https://www.bsz-bw.de/depot/media/3400000/3421000/3421308/01_0456.html
(Wilbert Ubbens, Rezension für Informationsmittel (IFB). Digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft, Jahrgang 28:2020, Heft 4, [#7105])
http://www.informationsmittel-fuer-bibliotheken.de/showfile.php?id=10604