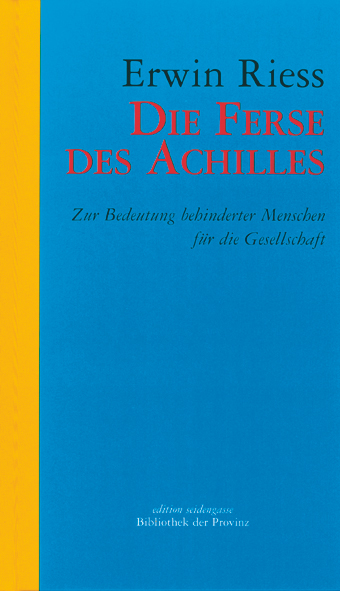
Die Ferse des Achilles
zur Bedeutung behinderter Menschen für die Gesellschaft
Erwin Riess
edition seidengasse: Karl Kraus Vorlesungen zur KulturkritikISBN: 978-3-902416-02-5
21 x 12 cm, 82 Seiten, Hardcover
10,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Kurzbeschreibung
[Wiener Karl Kraus Vorlesungen zur Kulturkritik, Band 2 | edition seidengasse]
»Wenn Elite irgendeine Funktion hat, dann die der indirekten Doch-Beeinflussung von Politik und Kunst. Das ist aber ausgeblieben. Alle Dinge, die differenziert nicht abgehandelt werden, kommen später vulgär zurück.« (Werner Schwab)
Seit dem Frühjahr 1987 laden die Wiener Vorlesungen Persönlichkeiten des intellektuellen Lebens dazu ein, ihre Analysen und Befunde zu den großen aktuellen Fragen und Problemen der Welt vorzulegen. Seit Beginn der Reihe waren über 1200 Referentinnen und Referenten bei den Wiener Vorlesungen zu Gast. Im Sinne des Diktums von Werner Schwab geht es den Wiener Vorlesungen um eine Schärfung des Blicks auf die Differenziertheit und oft auch Widersprüchlichkeit der gesellschaftlichen und kulturellen Wirklichkeit.
Mit dem Vortrag von Erwin Riess und dem nun vorliegenden Band setzen die Wiener Vorlesungen die Reihe »Karl Kraus Vorlesungen zur Kulturkritik« fort. Karl Kraus war einer der pointiertesten Politik-, Kultur-, Ideologie- und Sprachkritiker des 20. Jahrhunderts. Seine Texte, die er bei 700 Vorlesungen zwischen 1910 und 1936 zum größten Teil in Wien vorgetragen hat, richteten sich gegen Verlogenheit, Sensationsgier, Kriegstreiberei, Doppelmoral, Lüge und Kitsch. Mit seinen Vorlesungen erreichte Karl Kraus ein großes Publikum. Er hatte einen präzisen Blick auf die politischen und kulturellen Entwicklungen seiner Zeit, die er kritisch kommentierte und deren Konsequenzen er mit großer Klarheit vorhersah.
Mit den »Karl Kraus Vorlesungen zur Kulturkritik« nehmen die Wiener Vorlesungen die Tradition einer im Befund genauen und im Ausdruck geschliffenen und pointierten Kulturkritik, wie sie u.a. von Karl Kraus, Anton Kuh und Egon Friedell gepflegt wurde, wieder auf. Bei der Formulierung der Zielsetzungen dieses neuen Projektes der Wiener Vorlesungen war unsere erste Prämisse, dass unsere Kultur, die durch Konsumindustrie und Populismus konsequent vernebelt wird, Impulse der Aufhellung, der Aufklärung, der Auseinandersetzung und der Kritik braucht. Der Hauptstrom der medialen Produktion dient – nicht anders als in anderen Epochen der Geschichte – der Affirmation dessen, was sich machtvoll Geltung und Durchsetzung verschafft. Kulturkritik wird derzeit häufig als fatalistische und defensive Haltung denunziert; von »Kulturpessimismus« ist dann die Rede, weil es leichter ist, Kritik mit der Phrase der Fortschrittsfeindlichkeit zurückzuweisen, als sich mit ihren Inhalten auseinander zusetzen ...
Rezensionen
Christian Pichler: Behinderte: Mühsamer Weg zur Gleichberechtigung1991 trat in den USA das Antidiskriminierungsgesetz „Americans with Disabilities-Act“ in kraft. Vor Ort erfuhr der Wiener Schriftsteller Erwin Riess – er sitzt selbst im Rollstuhl –, wie innerhalb weniger Monate plötzlich alle Busse und die überwiegende Zahl der Geschäfte für Menschen mit Behinderung erreichbar und benutzbar wurden. Dadurch, schreibt Riess, habe sich weiters die Zahl der Behinderten „auf freier Wildbahn“ drastisch erhöht. Zudem hätten Freundlichkeit und Höflichkeit der Bevölkerung, „von der Kellnerin bis zum Börsianer“, gegenüber Behinderten spürbar zugenommen.
Welche Bedeutung haben behinderte Menschen für eine Gesellschaft? Wie, dies vor allem, lässt sich ihre Situation, die oft genug mit Benachteiligungen im Alltag verbunden ist, verbessern? Erwin Riess hat sich im Rahmen der „Wiener Karl Kraus Vorlesungen zur Kulturkritik“ ausführlich des Themas angenommen, sein Beitrag liegt nun unter dem Titel „Die Ferse des Achilles“ bei der Bibliothek der Provinz vor. Eine zentrale These, passend zum eingangs geschilderten Szenario: Riess hält den US-amerikanischen Weg für den ungleich effizienteren, nämlich zuerst die BürgerInnenrechte von Behinderten gesetzlich zu fixieren und erst im zweiten Schritt eine bessere Sozialversorgung anzustreben. Der umgekehrte, europäische Weg – zuerst auf sozialstaatlichen Leistungen zu beharren unter fast völliger Außerachtlassung der BürgerInnenrechte – lasse allzu rasch emanzipatorische Energien verpuffen: Behinderte würden so stets zu Bittstellern degradiert – Mitleid statt Akzeptanz.
Riess, ein begnadeter Sprachartist, ist hier sichlich um Sachlichkeit, um einen möglichst objektiven Ton bemüht, vermeidet Ironie. Nur selten entfährt ihm ein Satz wie jener, in dem er die Ignoranz von MitbürgerInnen attackiert, „die die für uns reservierten Parkplätze blockieren und, darauf angesprochen, antworten, sie würden ja ohnehin für ,Licht ins Dunkel´ spenden.“ Diese Heftigkeit allerdings ist verständlich, ist sich doch Riess völlig dessen bewusst, dass eine komplette Gleichstellung von Nicht- und Behinderten wohl noch lange Illusion bleiben wird. Zu sehr benötigt die Obrigkeit „den Behinderten“:
„Sind wir eine gesellschaftliche Abschreckungs- und Disziplinierungswaffe? Ist es unsere Rolle, andere Gruppen der Gesellschaft – Drogenabhängige, Zuwanderer, Obdachlose und andere – mit dem ihnen zugewiesenen Platz zu versöhnen, indem man mit dem Finger auf uns zeigt und uns vom Dunkel in gleißendes Scheinwerferlicht holt: Seht her, diesen Gezeichneten geht es noch schlechter. Seid froh, dass ihr laufen könnt! Findet euch gefälligst mit eurem Schicksal ab!“
Anhand einer Fülle von Beispielen dokumentiert Riess, wie in der – österreichischen – Praxis noch vieles im Argen liegt. Besonders skurril mutet das Beispiel McDonald´s an: Die Fast-Food -Kette, die in den meisten Ländern für ihre vorbildlich erreichbaren Lokale mit Behindertenparkplätzen und -toiletten bekannt ist, befleißige sich in Österreich keineswegs dieser Tugend. In einem Gespräch mit dem zuständigen Bauleiter für McDonald´s Österreich erfuhr Riess, dass firmenintern Österreich nicht als europäisches, sondern als Drittweltland geführt werde, wo auf Zugänglichkeit für alle mangels einschlägiger Gesetze nicht geachtet werden müsse.
Was ist zu tun? Riess empfiehlt zum einen, bestehendes Recht in die Praxis umzusetzen: „Das Behindertenkonzept der österreichischen Bundesregierung zum Beispiel, das unter Mitarbeit der Behindertenverbände vom Sozialministerium 1992 vorgelegt wurde, böte für lange Zeit Umsetzungsstoff.“ Zum anderen kritisiert Riess den „Ablenkungs- und Feigenblattcharakter“ mancher Gesetzestexte. So wurden etwa in den 1990-er Jahren in Deutschland und Österreich Verfassungszusätze eingeführt, die festschreiben, dass niemand aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Da dieser Grundsatz aber nicht in Gesetzen konkretisiert wurde, hätten weder Organisationen noch Individuen einklagbare Rechte. Alleine eine Willenserklärung brächte Behinderte auf ihrem Weg zur rechtlichen Gleichstellung mit Nicht-Behinderten nicht weiter.
(Christian Pichler, Rezension erschienen auf der Webseite des StifterHaus Linz)
