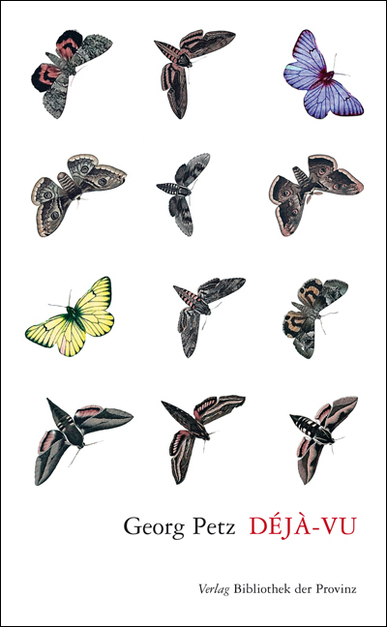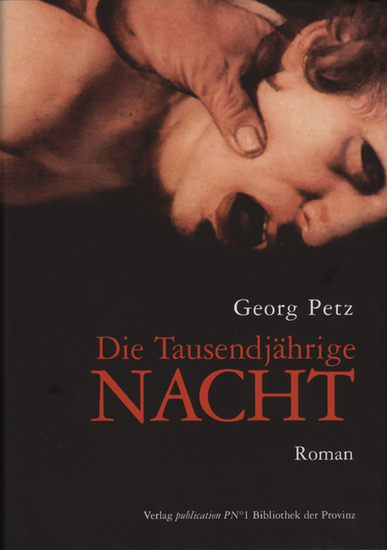
Die tausendjährige Nacht
Roman
Georg Petz
ISBN: 978-3-85252-743-7
21 x 15 cm, 424 S.
34,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Kurzbeschreibung
Jemand musste G. gestoßen haben, denn ohne dass er gestolpert wäre, stürzte er in den Abendstunden eines trägen Sommertages die Treppe zu seinem Zimmer hinab – einen engen, hölzernen Schacht über zumindest drei Stockwerke, bevor sein Körper, längst bewusstloses Fleisch geworden, mit einem dumpfen Ton im Parterre aufschlug. Dort lag er dann, reglos und zumindest nach den Worten einiger später hinzugekommener Schaulustiger auch bereits leblos, auf den fahlgelben Kacheln des Stiegenhauses. Atmete vielleicht nicht mehr. Blutete auch nicht. Verströmte nur noch Wärme und den sonderbar dünnen Sauermilchgeruch organischer Strukturen als letztes, nach und nach verebbendes Anzeichen einer Menschlichkeit und ihrer vergehenden Existenz. G.s Nachbarin auf der unteren Etage des Hauses entdeckte seinen zerschlagenen Körper als Erste nach dem Sturz – bereits nach wenigen Minuten, was ihm wahrscheinlich auch die Reste des in ihm verbliebenen Lebens rettete –, weil sie dem befremdlichen Poltergeräusch vor ihrer Türe auf den Grund gehen wollte, und ebendort lag G. ohnmächtig ausgebreitet. Sie fand Schleifspuren im dunklen Holz der Wandvertäfelungen im Stiegenhaus und Schlaglöcher, die hell aus den Holzpaneelen hervorstachen, wo er im Fallen mit seinen Schuhen dagegen geprallt war. Die Nachbarin las akribisch in jenen unfreiwillig angeschlagenen Materialschäden, fand ausgerissenes Haar in den Verstrebungen des Treppengeländers oder Häufchen von Sägemehl. Sie tastete sich an dieser Spur der Zerstörung immer tiefer die engen Treppenkehren hinab, bis sie im Erdgeschoß endlich auf die verbliebene Masse von G.s Körper trat. Sie sah nach oben zu seiner Dachkammer, von wo er herabgefallen sein musste, aber das andere Ende des Treppenhauses war im Dunkel nicht mehr zu erkennen. War versunken in den Schatten unter dem Dach und nichts, auch keine Bewegung darin, die sie hätte ausmachen können …
Rezensionen
Eva Schäffer: Grandiose Reise an den Beginn der langen NachtKraftvoll, poetisch, visionär, facettenreich und spannend: Mit "Die Tausendjährige Nacht" legt Georg Petz ein schlichtweg sensationelles Romandebüt vor.
Ein Mann namens G. stürzt in dem Haus, in dem er wohnt, die Treppe hinunter, durch drei Stockwerke bis ins Erdgeschoß. Gefunden wird ein Körper, der nahezu keinen heilen Knochen mehr .aufweist, aber noch atmet, lebt. G. erwacht in einem Lazarett, in dem ihn kündige Ärzte auf ebenso raffinierte wie riskante Art zusammenzuflicken, zu "montieren" versuchen. Bei seinem Erwachen findet er an seiner Seite ein Mädchen, das offenbar die Aufgabe hat, ihn zu betreuen; auch die Aufgabe, ihm von Geschehen zu berichten. Denn G. hat durch den Sturz, dessen Ursache im Dunkeln liegt, sein Gedächtnis verloren. Esther, diesen alttestamentarischen Namen, führt das Mädchen, erzählt nun G. minutiös, was passiert ist.
Der Bericht aber führt langsam und stetig aus der Erinnerung an den sonderbaren Unfall weiter, buchstäblich hinaus in das Universum der Vergangenheit. Der Sturz in die Tiefe eröffnet gleichsam schauerliche wie faszinierende Tiefen.
Die Welt, die wir durch den Roman "Die Tausendjährige Nacht" des 28-jährigen, in Graz lebenden Schriftstellers Georg Petz betreten, erschließt uns nicht weniger als tausend Jahre Menschheitsgeschichte durch das reiche Wissen, durch kühle, scharfe Beobachtung eines Dichters. Es ist, wie zu erwarten, keine schöne Welt. Sie gleicht eher Scherbenhaufen, die sich nach Belieben gruppieren und zusammenfügen lassen. Grauenvolle Katastrophen, Machtspiele, folgenschwere Revolutionen verästeln sich mit leichten, facettenreichen Begebenheiten, mit wunderbaren poetischen Stimmungsbildern.
Seine starke, seine köstliche Spannung bezieht dieser nicht anders als meisterlich zu bezeichnende, atemberaubende, wahrhaftig abgründige Texte aus der feinen, souveränen Gelassenheit des Schreibers, aus dem unaufhaltsam weiterdrängenden Fluss der Sprache. Die unzähligen Geschichten, Berichte, Schilderungen türmen sich zu einem imposanten Massiv, dessen Bewältigung lustvolle Herausforderung ist. Ein rarer, großer Glücksfall.
(Eva Schäffer, Rezension in: Kleine Zeitung, 17. Juni 2006)
http://www.georgpetz.at/rezensionnachtkleine.pdf
Ingeborg Sperl: Sintflut und Welttheater
Georg Petz und seine eigenwillige Interpretation der Zivilisationsgeschichte
Nicht gerade tausend Jahre, aber doch ziemlich lange laboriert man an dem dicken Roman Die tausendjährige Nacht von Georg Petz. Das Setting des jungen, in Graz lebenden Autors gleicht ein wenig der TV-Kultserie Lost. Eine Gruppe Menschen findet sich nach einem Flugzeugabsturz in einer wilden Gegend ohne geografische Koordinaten und ohne Gedächtnis wieder. Die Leute fallen in die absolute Geschichtslosigkeit. Das klingt wie der Auftakt zu einem Survival-Abenteuer, möglicherweise mit einer Horror-Komponente à la Herr der Fliegen. Aber Petz schwebte offenbar etwas gänzlich anderes vor, nur was, das ist schon schwerer herauszufinden. Zunächst ist also einmal Tabula rasa; die Gesellschaft muss sich von Neuem erfinden. Als die Überlebenden zu den lang verlassenen Ruinen der Stadt eines unbekannten Volkes kommen, entscheidet ein demokratisches Würfelspiel über die Verteilung der Rollen und Wohnressourcen.
Alles katalogisiert
Petz geht dabei nicht auf individuelle Schicksale oder auf real existierende Überlebensfragen ein, auch dann nicht, als eine Art Sintflut die Reste der Stadt heimsucht und man danach das ganze urbane Gefüge sozial und planerisch neu ordnen muss. Ordnen, aufzeichnen, katalogisieren, das ist die Leidenschaft des in einem abgehobenen Bibliotheksturm hausenden Chronisten G., der sich in der Rahmenhandlung als Schwerverletzter mit zahllosen Knochenbrüchen im Lazarettgebäude wiederfindet. Abermals mit einer Amnesie geschlagen und von einer Prostituierten gepflegt, wird die ihm die Geschichte der Stadt und seines Wirkens in ihr von Neuem erzählen. Was Petz hier unternimmt, ist der Versuch einer kursorischen, eigenwilligen Interpretation des Zivilisationsprozesses, gleichzeitig versucht er eine Reflexion über das Erzählen an sich. Dieses beginnt mit dem Bemühen einer „objektiven“ Aufzählung der „Fakten“ und endet mit der Hereinnahme der Poesie, des eigenen Standpunktes in dem Maße, in dem der Geschichtsaufzeichner als nicht mehr staatstragend erkannt wird.
Der Chronist G. gibt sich lange der Vorstellung hin, dass das, was er so emsig und auf Vollständigkeit bedacht aufschreibt, zu einem sinnvollen Ganzen zu fügen sei, eine Illusion, wie er zuletzt erkennen muss. Petz verwebt in seinem beziehungsreichen Labyrinth Anspielungen aus der Literaturgeschichte, von den Merseburger Zaubersprüchen über Umberto Eco bis zu Karl Kraus, er verwendet sie auch als Motto über den Kapiteln und überlässt es dem Lesenden, die Assoziationen selbst herzustellen. Die Auseinanderdifferenzierung einer ursprünglich als egalitär gedachten Gesellschaftsordnung ist jedenfalls auch in dieser fiktiven Variante der Geschichte nicht aufzuhalten.
Von der Urgesellschaft zur Massenverelendung, von der Revolution bis zur Individualisierung spielt Petz das Welttheater punktuell und selektiv nach. Das alles wirkt artifiziell, ja manieristisch, zumal sich der Autor in langen und kompliziert gebauten Sätzen ergeht und dabei emotional eine bemerkenswerte Neutralität bewahrt. Was auf jeden Fall beeindruckt, sind die Hartnäckigkeit und die Originalität, mit denen Petz sein ausuferndes Romanprojekt betreibt. Diese Ernsthaftigkeit ironisiert er selbst in dem kulturpessimistischen Exkurs, in dem die postmodern gereiften Vertreter der Macht dem Chronisten dessen Unzeitgemäßheit und Schwerfälligkeit vorwerfen. Er solle doch, so wird er angehalten, endlich den Geschmack des unterhalten sein wollenden Publikums treffen. Der Kulturbetrieb müsse sich schließlich rechnen. Alles wie gehabt, – da bleibt den Dichter-Chronisten nur mehr die Rückkehr ins Wasser, von wo einst alle Lebewesen an Land stiegen.
(Ingeborg Sperl, Rezension in: Der Standard, 21.10.2006)
http://derstandard.at/2632148