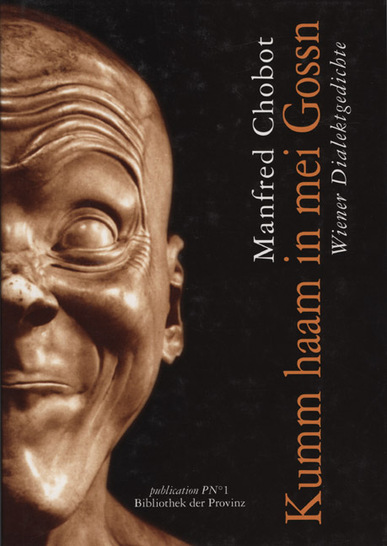
Kumm haam in mei Gossn
Wiener Dialektgedichte
Manfred Chobot
ISBN: 978-3-85252-341-5
21 x 15 cm, 142 S.
15,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Kurzbeschreibung
entschuidigns
entschuidigns d schtearung i kumm fom blindnfabaund brauchns biaschtn oda besn?
fua da tia schteet a oida maun mit an graun maunti brauchns ka biaschtn flan buggl oda fias auto
i brauch niks naa hob i gsogt naa daunkschee i hob ois kaun ma niks mochn niks fia unguat i hob nua gfrogt ea hot gseifzt d schuitan zukkt und is gaunga
entschuidigns d schtearung i kumm fom blindnfabaund brauchns biaschtn oda besn?
i brauch fü net wos hob i ois wos i goa net brauch fia wü fü scheiss hob i scho gööd aussegschmissn soit dea oide wida kumma kauf i eam wos o
mia san net blind mia segn ois mia haum den duachblik anschtott wos zkaufn schreib i jezt a teppates gedieht entschuidigns d schtearung i kumm fom blindnfabaund brauchns flleicht a brüün?
kumm haam in mei gossn
di haums schlecht behaundit dei lebn laung dia is miis gaunga dei lebn laung ma hoc di betrogn beschtoin belogn kumm haam in mei gossn
oiweu hod ma di tredn farodn faschachat i hob dia ois gebn wos i ghobt hob oba du host mi belogn faschachat betrogn kumm haam in mein gossn
du woast a fuazugs-schülarin host ois peafekt daleant se haum dia gleant faochtn betriagn gwöön und du host gleant mi zfarodn mi ausznuzn ztredn
kumm haam in mei gossn
kumm haam
Rezensionen
Richard Christ: "Gschichtn denk i ma söba aus …"Ein neuer Lyrikband des Wieners Manfred Chobot
Es ist nicht der erste Lyrikband im Wiener Dialekt, den Manfred Chobot (Jahrgang 1947) herausgebracht hat, aber der umfangreichste (150 Seiten, Bibliothek der Provinz, Weitra, Titel "Kumm haam in mei Gossn"); überdies hatte Chobot mit Bernhard C. Bünker eine Anthologie mit österreichischer Dialektdichtung von 1970 bis 1980 herausgegeben. Mir ist damals schon aufgegangen, welch ganz andere Rolle Dialektliteratur in Österreich spielt als in Deutschland. Bei uns geraten Texte außerhalb des Schriftdeutschen doch leicht in die Nähe des Komischen, gewollt oder unbeabsichtigt, etwa im Sächsischen, Bayrischen, Schwäbischen, in Kölsch, Pfälzisch, im Berliner- oder Ruhrpott-Jargon. Der Dialekt sperrt sich im Deutschen oft der Behandlung seriöser, komplizierter, anspruchsvoller Inhalte. Anders in Österreich, mit dem wir angeblich die deutsche Schriftsprache teilen. Die "Tiroler Tageszeitung" schrieb über die genannte Anthologie: "Der Dialekt hat längst das Terrain heiter-besinnlicher Betrachtungen im verklärten ländlichen Bereich verlassen. Er ist Stilmittel geworden, viel mehr aber noch hautnächstes Medium, um Unbehagen zu artikulieren, Mittel, um das, was gedacht und gefühlt wird, möglichst ohne Zwischenrufe zu formulieren. Im Dialekt wird heute vorwiegend Kritik betrieben... Man macht sich die Kraft der Sprache, die Unverblümtheit des Stils und den ... hohen Gefühlswert des Dialekts zunutze, um fast schon Sprachloses einzufangen, um typische Situationen unverfälscht wiederzugeben, um Gedanken das treffende Umfeld zu schaffen." Beweis für die uneingeschränkte Verwendbarkeit des Dialekts ist das Werk des kürzlich verstorbenen H.C. Artmann.
Auch Chobots Gedichte umspannen einen weiten Themenkreis, die Rede ist von Gott und der Welt, Alltäglichem und Ausgefallenem, vieles wird in großer Anschaulichkeit und Derbheit demonstriert. Wegen der konsequenten phonetischen Wiedergabe der Texte, der Kleinschreibung, der fehlenden Interpunktion sind sie dem hochdeutsch Sprechenden bzw. Lesenden eher verständlich, wenn er sie "mit dem Ohr" liest. Als Beispiel wähle ich ein Gedicht mit einer Art weltanschaulichem Credo:
i glaub
i glaub net draun
dass a leben nochn tod
gibt
fon an doppla
densd nidagsoffn host
bleibt de floschn
und a druk auf da blosn
wosd aussebrunzt
rinnt obe ins heisl
mia kaun kana wos dazöön
gschichtn denk i ma söba aus
(Richard Christ, Rezension in: Gegengift. Zeitschrift für Kultur, 15. Januar 2001)
http://www.chobot.at/body_ausgew_kritiken_10.htm
Weitere Bücher des Autor*s im Verlag:
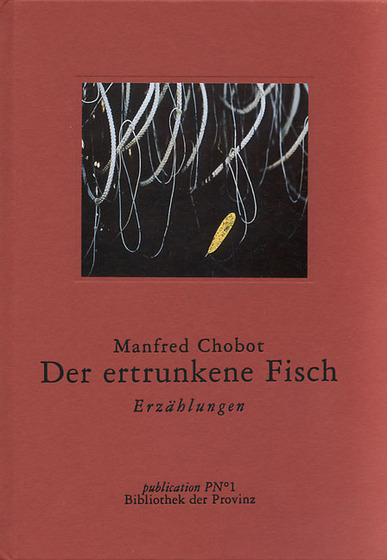
Der ertrunkene Fisch

Der Hof
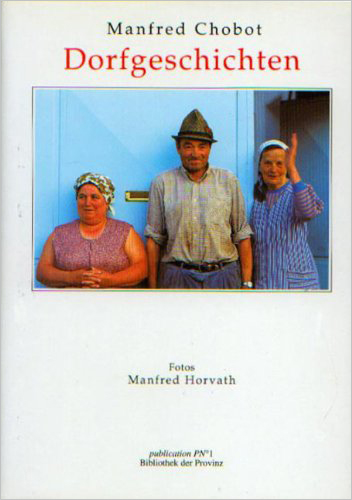
Dorfgeschichten
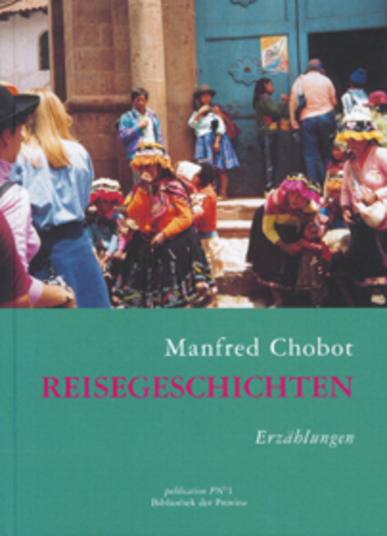
Reisegeschichten
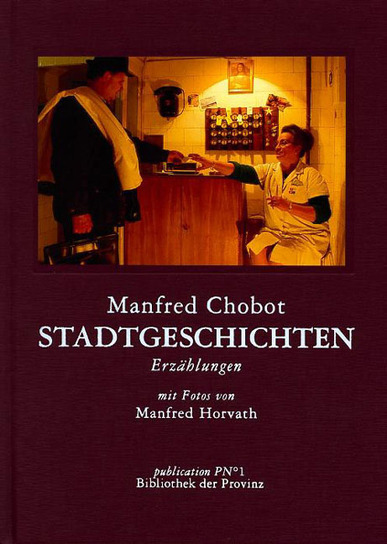
Stadtgeschichten
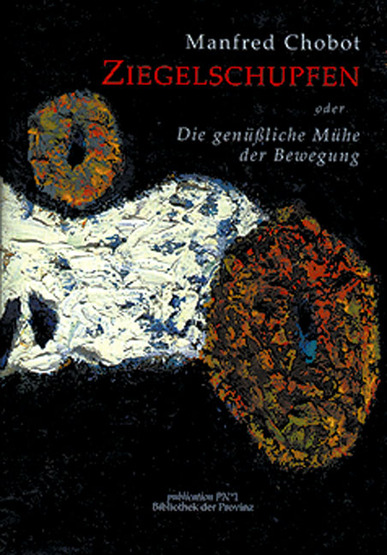
Ziegelschupfen oder die genüßliche Mühe der Bewegung
