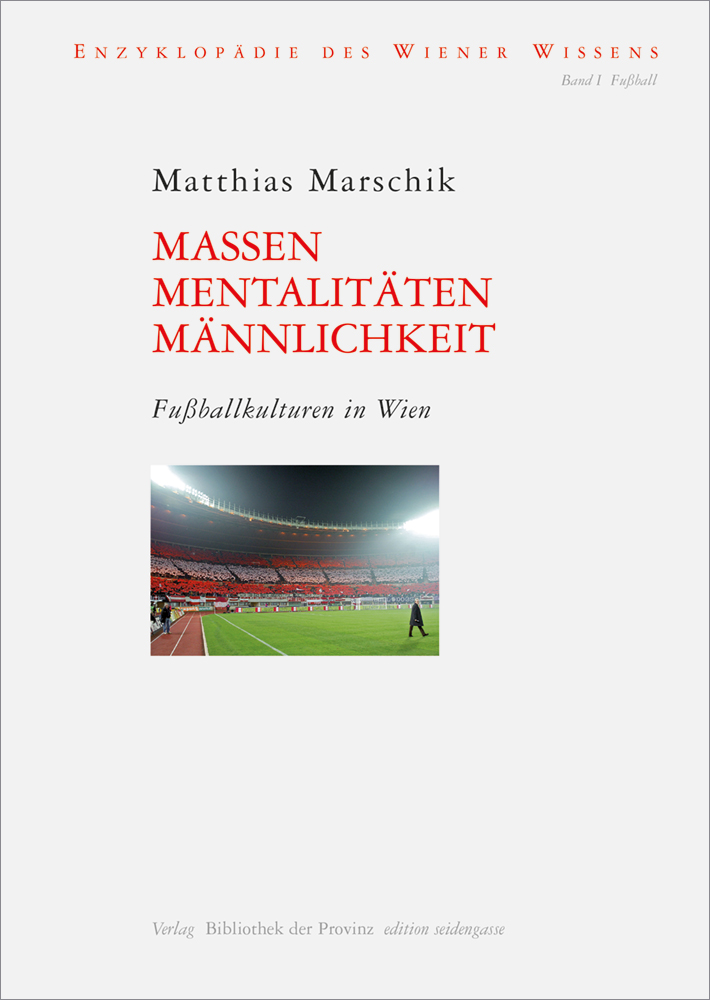
Massen, Mentalitäten, Männlichkeit
Fußballkulturen in Wien
Matthias Marschik
edition seidengasse: Enzyklopädie des Wiener WissensISBN: 978-3-902416-03-2
21×15 cm, 164 Seiten, zahlr. S/W-Abb., Hardcover
18,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
Überall dort, wo der Fußball, so wie in Wien oder – viel später – auch in Österreich, eine populare Massenkultur darstellt, kulminieren in diesem Sport paradigmatisch die sozialen und gesellschaftlichen Zustände dieses Territoriums.
Importiert als Schulspiel zur Ertüchtigung der männlichen Jugend in den 1880er Jahren, wurde der Fußball um 1890 von in Wien tätigen Engländern aufgegriffen. Im Spannungsfeld zwischen bürgerlich-ökonomischem und sozialdemokratisch-politischem Fußball entstand ein weites Feld eines genuinen Arbeiterfußballs, der fast die ganze männliche Wiener Bevölkerung in seinen Bann zog und dabei als Popularkultur im Dreieck Wien-Prag-Budapest spezifisch wienerische Eigenschaften entwickelte.
Mit dem Verbot des sozialdemokratischen Sportes im Februar 1934 wurde die bürgerlich-zweckfreie, kapitalistische Variante des Fußballs durchgesetzt. Die Ära des Nationalsozialismus brachte zwar massive Eingriffe in Sportkonzepte und -praxen mit sich, die Massenkultur des Wiener Fußballs tangierte sie aber kaum. In einem Zusammenspiel von resistentem Fußball und instrumentalisierendem Regime blieb dieser Sport ein Wiener Phänomen und wurde zu einer wesentlichen Form des Aufbegehrens gegen die ›Deutschen‹. Auch noch der dritte Endrang bei der WM 1954 war Ergebnis der Wiener Mischung aus letztem Einsatz und ballverliebtem Scheiberlspiel.
Erst Ende der 1950er Jahre begannen veränderte Rahmenbedingungen die Wiener Fußballpraxen im Sinne einer »Verösterreicherung« zu beenden. Dieser Prozess wurde bald darauf durch eine »Europäisierung« weitergeführt, die den Wiener Fußball in die zweite Reihe zurückstufte. Mit einer kurzen Unterbrechung an der Wende von den 1970er zu den 1980er Jahren musste sich der Wiener Fußball seitdem mit einem Schattendasein und einer meist nur mehr lokalen Präsenz bescheiden.
Doch trotz mäßiger Leistungen, massiven Zuschauerrückgängen und der Einbettung in europäische bzw. globale Strukturen, die ihm nur mehr Chancen des Reagierens auf internationale Entwicklungen offen lassen, ist der Wiener Fußball nicht untergegangen: Finden wir seine konkreten Manifestationen nur mehr im lokalen Fußball und im Stadthallenturnier, lebt er ideell in den Mythen und Geschichten rund um den Fußball weiter und diese Traditionen und Mythen haben in der enormen alltagskulturellen Bedeutung des Wiener Fußballs ebenso ihren Niederschlag gefunden, wie sie (bislang) dem Phänomen Frank Stronach Paroli boten: »Seine« Austria ist noch immer die launische Diva wie ehedem und die kampfbereite Rapid ist ihr eherner Widerpart.
[Enzyklopädisches Stichwort]
[edition seidengasse · Enzyklopädie des Wiener Wissens, Bd. I |
Hrsg. von Hubert Christian Ehalt für die Wiener Vorlesungen, Dialogforum der Stadt Wien]
Rezensionen
gs: Von Sindelar zu StronachDer Kulturwissenschafter und ballestererfm-Autor Matthias Marschik gehört zu den verdientesten und produktivsten Fußball-Historikern Österreichs. In »Massen, Mentalitäten, Männlichkeit. Fußballkulturen in Wien« liefert er einen handlichen Überblick über die Geschichte des Wiener Fußballs von den Anfängen im ausgehenden 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
Die Wiener Fußballkultur ist für Marschik dabei mehr als nur ein »Abbild« der Stadt und seiner Gesellschaft. Die Mythen und Heldenfiguren des Sports sind vielmehr wichtige Teile einer Wiener »Mentalität«, die von den Beteiligten, von den Fans bis zu den Sportmedien, aktiv erzeugt werden.
Fußball in Wien lebte auch immer von Gegensätzen: Bürgertum und Arbeiterschaft, Café und Vorstadt, lokale Verwurzelung und Zuwanderung, Kampf und Technik. Und nicht zuletzt gab es die Konkurrenz mit der »Provinz«, die spätestens ab der Einführung einer österreichischen Liga im Jahre 1949 ihren Anfang nahm. Österreichischer Fußball, das hieß lange eigentlich: Wiener Fußball. Das Buch führt zurück in die goldenen Zeiten der hauptstädtischen Fußballkultur, erzählt vom Wunderteam oder den Nachkriegsjahrzehnten, als bis zu 90.000 Zuschauer bei Länderspielen das Praterstadion bevölkerten.
Wer wissenschaftliche Sprache nicht gewöhnt ist, wird sich durch die leicht vertrackte Einleitung kämpfen müssen. Ansonsten aber Pflichtlektüre für das nächste Fußball-Proseminar.
(gs, Rezension im
http://legacy.ballesterer.at/heft/weitere-artikel/rezensionen-5.html
H.-Georg Lützenkirchen: Das „kleine Glück“ im Sport
Vom Gesellschaftsbezug des Sports handel[t] Mathias Marschiks Studie zu „Fußballkulturen in Wien“ (…)
Österreich und Fußball – das mutet dem zeitgenössischen Beobachter nicht eben als eine besonders glückliche Konstellation an. Während der Fußball-Europameisterschaft 2008, die in Österreich und der Schweiz stattfand, konnte man in Interviews skeptische Fußballkommentatoren hören, die mit achselzuckender Selbstverständlichkeit darauf hinwiesen, dass dieses Fußballereignis für Österreich vor allem deshalb ein Glück gewesen sei, weil die Nationalmannschaft als das Team eines der Gastgeber zumindest einmal auf diese Weise an einem großen Turnier teilnehmen könne. Sportlich habe sie keine Chance, sich zu qualifizieren. Als dann die Mannschaft während der Vorrunde gegen Deutschland spielen musste, wurden die Gefühlswelten der österreichischen Fußballnation auf geradezu komische Art deutlich. Überall hörte man das „I wer' narrisch!“ des österreichischen Rundfunkreporters Edi Finger. Finger kommentierte das WM-Spiel Deutschland gegen Österreich 1978 im argentinischen Córdoba. Hans Krankl schoss damals das Tor zum 3:2 für die Österreicher, mit dem sie den damals amtierenden Weltmeister Deutschland schlugen. Als „Wunder von Córdoba“ besetzt das Ereignis seitdem die Seelen österreichischer Fußballenthusiasten.
So groß dieses Wunder gewesen sein mag, so enttäuschend war alles, was danach kam. In der aktuellen FIFA-Rangliste findet sich Österreich auf dem 105. Rang.
Das war nicht immer so. Der Fußball in Österreich hatte einstmals nicht nur eine eigene ästhetisch-sportliche Qualität, die ihn „legendär“ machte, sondern er spielte auch als soziokulturelles Identifikationsmodell für viele Menschen eine besondere Rolle. Matthias Marschik geht in seiner Untersuchung „Massen, Menatilitäten, Männlichkeit“ über die „Fußballkulturen in Wien“ noch einen Schritt weiter: Der populäre Massensport Fußball „bildet keineswegs nur ein Abbild gesellschaftlicher, politischer und ökonomischer Prämissen, sondern bildet eigene Sportkulturen heraus, die Entwicklungen in anderen Feldern der Gesellschaft vorwegnehmen oder abändern oder auch eigenständige Bedeutungen auf- und ausbauen können.“ Im speziellen Fall des Wiener Fußballsports ist dieser also nicht nur „Abbild einer Wiener Identität“, sondern leistet eigenständige Beiträge zur „Ausbildung, Aufrechterhaltung oder Veränderung einer urbanen Wiener Mentalität.“
Diese Bedeutung des Fußballs gründet zunächst auf der besonderen Stellung, die diese Disziplin im Vergleich mit anderen Sportarten genießt. Fußball diente deshalb immer schon als eine Art „Realitätsmodell“ (Klaus Theweleit), aus dessen Analyse Vergleichbarkeiten zur ,realen Welt' des Politischen hergestellt werden sollten. Marschik bezieht sich einleitend indes nur knapp auf Konzepte zur Parallelisierung des Politischen mit dem Fußballerischen, sondern widmet sich sogleich den spezifischen Wiener Voraussetzungen. Hier wurde der Fußballsport seit den 1920er-Jahren zum dominierenden Sportzweig, „was seine massenkulturelle Präsenz und seine populäre Repräsentationen betrifft.“ Hinzu kommt freilich noch eine spezifische Wiener Melange: „Die Wiener Fußballkultur basiert letztlich auf der besonderen Mischung von ,Ordnung und Unordnung' (…), verbunden mit einer dem Sport immer wieder nachgesagten, wenn auch nie wirklich existierenden, Neutralität und politischen Absenz sowie dem Gefühl des Kleinen Glücks, wie es gerade in der Möglichkeit des Sieges des Kleinen gegen den Großen (…) zu finden ist.“
In einem „historischen Längschnitt“ beleuchtet der Band die Wiener Fußballkulturen. Der Streifzug durch die Historie beginnt um 1900, als der ,englische' Sport in Wien durch die Verbandsgründung ,ordentlich' in die bürgerliche Welt integriert wurde. Daran änderte auch die bald schon wachsende Popularität des Sports in der Arbeiterschaft nicht grundlegend etwas. Die „bürgerliche Hegemonie“ über den Fußball blieb ungebrochen. Trotzdem trugen zur Popularisierung des Massensports Fußball in Wien seit den 1920er-Jahren gerade die Stadtduelle zwischen der ,bürgerlichen' Austria und dem „1. Wiener Arbeiter-Fußballklub“, dem Sportklub Rapid bei. Aber es war nicht nur die ,soziale Konkurrenz', die das Duell attraktiv machte. Beide Vereine repräsentierten auch die bestimmenden Auffassungen des Wiener Fußballs. Hier das technikbetonte körperlose Spiel, das von Spielern wie dem „Papierenen“, Matthias Sindelar, zur erfolgreichen Fußballkunst veredelt wurde – dort der zähe, auf Kondition basierende Kampfgeist des Arbeiterklubs, in dessen berühmter „Rapid-Viertelstunde“ noch so manches Spiel gedreht wurde. Beide Spielweisen verschafften den Wienern (und den Österreichern) während der NS-Zeit „das kleine Glück“, als in den Spielen gegen Vereine des „Altreichs“ beeindruckende Siege errungen wurden. Geradezu idealisiert als eine Art österreichische Widerspenstigkeit gegen die Vereinnahmung des großen Nachbars wurde das mit „List, Kreativität und ,Wiener Schmäh'“ verbundene ,Scheiberlspiel', mit dem man dem einfallslosen deutschen ,Kraftfußball' begegnete. Ein schöner Trug …
Nach dem Krieg erlebte die „fußballerische Begeisterung in Wien“ noch einmal Höhepunkte. Sie kulminierte in der Begeisterung für die 1954er-Weltmeisterschaft im Nachbarland Schweiz. Doch wurde nun auch deutlich, „dass die lokale Fußballkultur (…) sukzessive durch ein sportliches Nationalgefühl verdrängt wurde.“ Die „Wiener Vorherrschaft im Fußball“ fand ihr Ende. Die „Verösterreicherung“ des Fußballs bedeutete aber zugleich auch eine Provinzialisierung. Im professionalisierten Spektakel des Weltfußballs spielt Österreich seitdem nur eine kleine Nebenrolle.
Wenn aber Matthias Marschik zum Ende seiner interessanten Studie „in den letzten Jahren eine Wiederkehr der Traditionen des Wiener Fußballs“ feststellt, dann ist dies auch ein Reflex auf die entfremdenden Mechanismen des ökonomisierten und globalisierten Fußballs. Es geht um die „Konstruktion eines Ortes, an dem in Zeiten der zunehmenden Fragmentierung von individueller Identität ein kollektives ,Wir'-Gefühl aufgebaut, in einer Phase der ,political correctness' bedingungslose Parteilichkeit gelebt werden kann.“ So wird das Stadion wieder zum „typisch wienerischen Ort“, dem „Refugium des ,kleinen Glücks'“.
Möglicherweise ist dieses „kleine Glück“ aber nur für den Preis einer Selbsttäuschung zu erringen. So wie die von Marschik als Selbsttäuschung identifizierte politische Neutralität des Sports; sie ist letztlich eine Idealisierung, die, um mit Max Frisch zu sprechen, die politische Parteinahme, die man vermeiden möchte, bereits vorgenommen hat. Dennoch werden derartige irreführenden Idealisierungen zuweilen auch als das „Spezifische“ des Sports herausgehoben, um diesen in der Konkurrenz zu anderen gesellschaftlichen Bereichen zu stärken. […]
(H.-Georg Lützenkirchen, Rezension für: literaturkritik.de Ausg. 08-2008, online veröffentlicht am 14. Juli 2008)
https://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=12122
