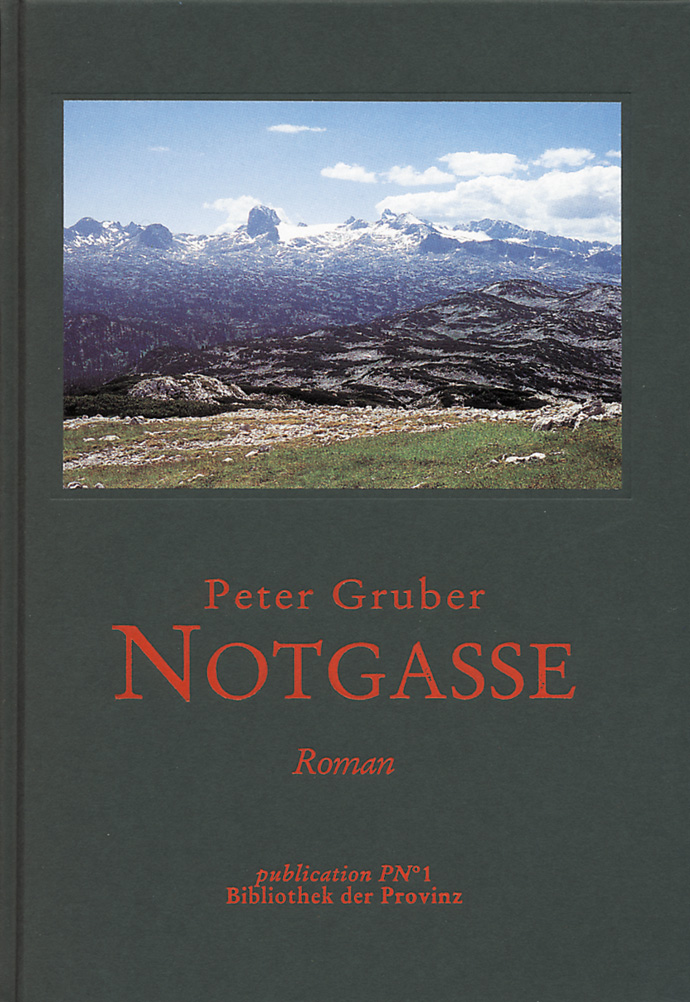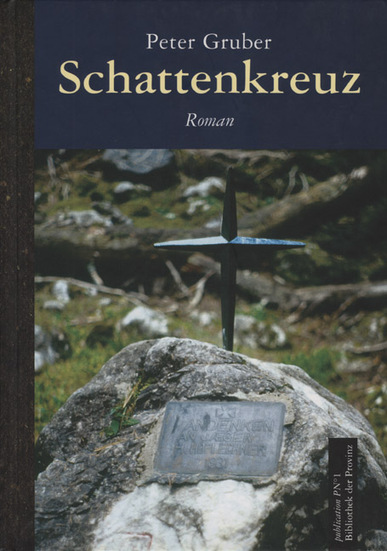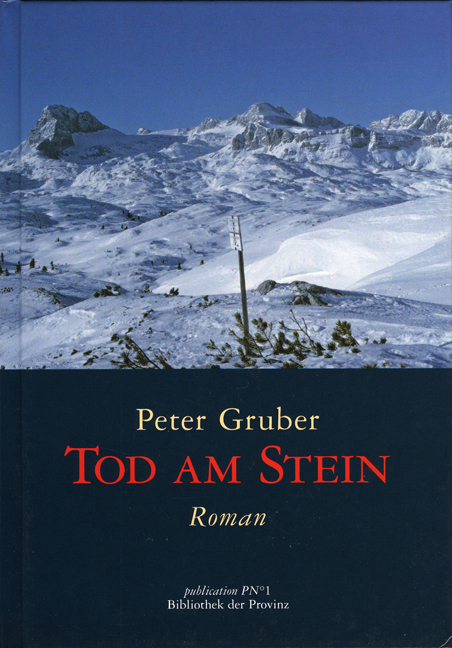Sommerschnee
Porträt eines Almlebens in gwändigen öden Gebürg
Peter Gruber, Kurt Hörbst
ISBN: 978-3-85252-963-9
21×15 cm, [250] Seiten, zahlr. S/W-Abb., Hardcover
25,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
Der »Hirte« lebt jeden Sommer mit einer kleinen Jungrinderherde auf einer Hochalm im Dachsteingebirge. Zu den Besonderheiten seines sommerlichen Lebens-Refugiums zählt vor allem, dass die Alm zum elterlichen Bergbauernhof gehört und ihm von Kindheit an vertraut ist. Diese Alm ist sehr exponiert inmitten einer spröden Karstlandschaft – laut Waldtomus (anno 1760) »in gwändigen öden Gebürg« – gelegen, abgeschieden von markierten Wanderwegen, fern von Erschließung, nur zu Fuß erreichbar, mit einer äußerst bescheidenen Infrastruktur. Der »Fotograf« hat den Hirten einige almsommerliche Abschnitte lang mitbegleitet und dessen Almleben aus der Schwarzweiß-Perspektive porträtiert. Ein Experiment, das eine Zeitlang aus dem Alleinsein des Hirten eine Zweisamkeit machte.
»Sommerschnee« veranschaulicht auf authentische, klare und stille Weise, zeitlos und geheimnisvoll erscheinend, das Leben des Hirten, mit Blicken auf die unmittelbare Umgebung und die labyrinthartige Karstlandschaft, die Bergnatur, das Wetter und vielerlei Almsommer-Tätigkeiten und Begegnungen. »Sommerschnee« ist das Porträt eines Almlebens in der Art eines szenischen Almsommertagebuches, das Leser und Betrachter mit einer selten gewordenen, vom Tourismus noch unberührt gebliebenen älplerisch-nomadisch, archaisch anmutenden Lebenswelt begegnen lässt.
Über den Almsattel geht der Wind, heißt es in den Almliedern. Tatsächlich ist es aber nicht nur der Wind, der darübergeht, sondern alles und jedes geht und kommt über den Almsattel, über den Rücken, diese Schulter, diese Breitscharte zwischen Höckern und Kogeln – eine Brücke zwischen Tal und Alm.
Mit dem Betreten der Almlandschaft über diesen Almsattel durch die Menschen und durch die Nutztiere verändert sich in dem Refugium vorübergehend alles, einen Sommer lang. Glockenklänge, Rinderrufe, Menschenstimmen vermengen sich mit den Lauten des Wildes, der Vögel und des Windes.
Auch der Hirte geht und kommt stets über den Almsattel, viele Male während des Sommers, wenn er von Talmärschen zurückkehrt oder von der Quelle mit frischem Trinkwasser oder vom Viehnachschauen oder von der Almzaunkontrolle.
Rezensionen
Martin Kubaczek: Portrait eines Almlebens in gwändigen öden GebürgFast wie ein Abschluss seiner Dachstein-Triologie wirkt dieses Buch. Peter Gruber, der seit einem Jahrzehnt quasi als Chronist einer ganz spezifischen Region arbeitet, hat drei historische Romane vorgelegt; die auf den Almen und in den Tälern um den Dachstein lokalisiert sind. Dieser Band nun ist ein Rückzug auf die Essenz und auf den Arbeitsort selbst: Viele der Texte entstanden im Geviert jener winzigen Hütte in einer Mulde mit dem Namen Wiesalm, auf 1654 Metern Höhe im östlichen Ausläufer des Dachsteinmassivs.
Gruber ist ein Kollege und Nachbar von Bodo Hell, was die Almarbeit betrifft, thematisch nicht so weit entfernt, was die Vermittlung von Kulturgeschichte, Volkswissen, Aberglaube und Alpinerfahrung betrifft, in seinem Textverfahren aber kompatibler. In diesem Band greift er zu einem Trick und erzählt in der dritten Person von sich und seiner Arbeit, verdichtet zehn Jahre Almsommer zu einem Zyklus, chronologisch vom Auftrieb bis zum frühen Kälteeinbruch mit Schnee, der zum überhasteten Rückzug aus der Höhe zwingt. Die Härten der Arbeit werden in allem fühlbar, ebenso aber die Detailgenauigkeit, zu der die Stille und das tägliche Suchen und Sorgen führt; Beobachtung ist das zentrale Wort, ein Schärfen der Sinne und Instinkte fürs Wettergeschehen und die Tierbewegung. Die Mühen des Alltags, vom Wassertragen bis zum Holzmachen, werden in Phasen zwischen Faszination, Hingabe und Erschöpfung vermittelt, in einer Situation, wo die tägliche Herausforderung und Exponiertheit zu einer Intensivierung aller Wahrnehmung führt.
Insofern ist Grubers Buch Essenz und Verdichtung dieser Exerzitien, denen er sich jeden Sommer wieder unterzieht. Eindrucksvoll, wie sich dabei langsam eine große Stille vermittelt, wie man in der Lektüre fast vermeint, das Rauschen in den Ohren zu hören, wenn es ringsum ganz still wird. Eigenartig berührt die Sorge um die kleine Herde – bloß zwölf Jungtiere, denen der Hirte suchend folgt oder vorangeht, die Verantwortung für Leben, in welcher Form immer, die er dabei verspürt, der Umgang mit den Ressourcen – das alles mündet hier in einem Wort: Achtsamkeit.
Gruber geht bewusst zurück auf eine Ebene des Verzichts. Die Senke seiner Alm am Karstplateau ist ein Winkel ohne Verfügbarkeit der Kommunikationsnetze, wo man mit dem Risiko und der Gefahr von Verletzung oder Krankheit im Bewusstsein lebt, dass man sich gegebenenfalls auch selber helfen muss. Der Hirte lebt hier, nicht als Besitzer, nicht als Verfügender oder Beherrschender, sondern als jemand, der eine Antwort finden muss auf die Fragen, die sich unerwartet und unvorhergesehen täglich ergeben: Das Versiegen der Quelle, das Siechen eines Kalbs, das Verlorengehen der Tiere im kaum überschaubaren Karst-Gelände, der Sturm, der riesige alte Bäume entwurzelt, Klimaveränderungen, die bis in diesen sensiblen Lebensraum spürbar werden.
Jeder Erzähl-Abschnitt des unpaginierten Buches ist lose auf ein Thema hin gefügt: Kräuter, Lieblingsplätze, Pflanzen; Wege, Spuren und Zeichen; der Charakter und die Eigenschaften der eigenwilligen, neugierigen und gutmütigen Rinder, ihr Kreisen um die Hütte, die Suche nach Nähe zum Hirten. Die Nachbaralmen und die spärlichen Bergwanderer; der Bauer, der die Almarbeit unterstützt, Tradition und Geschichte; Aberglaube, Geistergeschichten und Gespenster; Murmeltiere unterm Hüttenboden und andere Wild-Begegnungen; Bauernregeln und Wetterumschwünge; Einsamkeit und Bedenken; und in allem immer wieder: Der Erwerb des notwendigen Wissens, der Zuwachs an Kenntnissen, die Herbheit und die Schönheit der Erfahrungen, aber auch Angst und Isolation.
Gruber geht sie freiwillig ein, nimmt sie auf sich, als quasi kathartische Regelung, auch im Sinne einer Verantwortung für jenen Raum, der über viele Jahrhunderte, fast Jahrtausende hin, Siedlungs- und Lebensraum gewesen war, heute weitgehend brach liegt, seine Wirtschaftsfunktion verloren hat. Es geht hier, über das Wort Hirte hinaus, um ein Behüten, Schützen und Bewahren durch Weiterführen und Wieder-Benutzung. Das zeigt sich auch im Vokabular und in einer Sprache, die sich auf kaum mehr bekannte Technologien, auf Material- und Sachkenntnis dieses Lebensraums bezieht: Servitut, Bestoßung, Wüstung, Trempel, Roafmesser, Wegnoschen, Klieben, Roankerln, und immer wieder um Losplätze und das Losen nach den Tieren.
Die einzelnen Erzählabschnitte des durchkomponierten Buches sind durch die foto-essayistische Parallelerzählung begleitet und unterteilt. Die Bilder haben eine verhalten stille Sprache, unaufdringlich im Vermeiden direkten Hinsehens, beobachten sie zurückhaltend aus der Tiefe. Fokussiert wird oft neben die Objekte, und Kurt Hörbst arbeitet mit ungewöhnlichen Bild-Ausschnitten, um so auf Parallelstrukturen in Körper- und Landschaftslinien hinzuweisen, nie trivial, sondern liebevoll im Erkennen von Vertrautheit und Ähnlichkeiten. Die Bilder machen den Durst fühlbar, vermitteln Trockenheit und Hitze, die Winzigkeit und das Temporäre des Lebens. Nicht repräsentative Portraits, sondern der Blick auf die Landschaft und ihre Bedingungen stehen im Mittelpunkt, die kleinen Dinge einer Folklore, wie ein Transistorradio oder der blitzblanke Plumpsklodeckel, dazwischen die Suche nach Lösungen für anfallende Fragen, etwa wenn unter der Dachtraufe zwei Köpfe im Studieren der Schindeln sichtbar werden und man versucht ist, sich einen möglichen Dialog dazu vorzustellen.
In Bild wie Text werden gleichermaßen Reduktion und Zurücknahme der Person fühlbar, sind Organisches und Vergängliches immerzu präsent. Hörbst belässt manche Bilder fast scheu in Unschärfe, Askese und Kargheit des Karstplateaus werden in ihrer lautlosen Dramatik sichtbar, die Bildausschnitte dezentralisieren, stellen Personen oder Tiere nicht als Protagonisten ins Zentrum einer Landschaft, über die sie verfügten, sondern im Gegenteil: indem der Fotograf sie ins Off rückt, wird die Dominanz der Landschaft fühlbar, die durch ihre Sprödigkeit alles Leben in die Anpassung nötigt; und das zwingt zu genauer Beobachtung und Respekt vor den Bedingungen – eine Haltung, die für die Bücher von Peter Gruber typisch ist, deren Stille die Fotoessays genuin begleiten; ich würde fast sagen: mit hoher Musikalität.
(Martin Kubaczek, Rezension im Buchmagazin des Literaturhaus Wien online veröffentlicht am 11. März 2009)
https://www.literaturhaus-wien.at/review/sommerschnee/
Claudia Theiner: [Rezension]
Sommerzeit ist Almenzeit, auf den Almen des Dachsteins nicht anders als in den Südtiroler Bergen. Auf die Natur und die Abgeschiedenheit geworfen, zeichnen Peter Gruber (Autor in Wien und Hirte im Dachsteingebirge) und Kurt Hörbst (Fotograf mit Medienprojekten und Lehrtätigkeit) mit viel Unmittelbarkeit und Respekt ein Portrait des Almlebens. Schon der Almauftrieb ist ein Ritual, in das bis zum Himmelszelt alles eingebunden ist, von der frühmorgendlichen Luft und dem Kuckucksruf bis zu den Ängsten und Glückseligkeiten der bloßen Existenz. Auf der Alm sind Haus und Stall und die elektrische Weidesperre zu inspizieren, und der Hirte tut es mit Sorgfalt. Den Sommer über schaut er mit maßvoller Freude auf das Gedeihen seiner Herde und er spürt die Mystik des Almlebens auf, mit Innigkeit, aber ohne Pathos.Immer noch, so der Autor, sei die Alm ein Ort der Sehnsucht, aus der Amor und Pan sich nicht zurückgezogen haben, und wo Jodler mit der Landschaft eins werden. Plätze, Sagen und Legenden sind dieselben geblieben, wenn auch das frühere Almleben mit dem heutigen nicht zu vergleichen ist. Peter Gruber charakterisiert den Hirten als einen Einsiedler, der sich den Dimensionen der Gebirgsnatur öffnet, und als einen Freund der Tiere – für Gruber ist Hirtesein Herzensangelegenheit.
„Sommerschnee“ überzeugt durch die Authentizität, die in einer umfassenden archaischen Sinnlichkeit ruht. Mit feinem Gespür zeichnet der Autor ein schlüssiges, intimes Bild, und auch der Leser schmeckt das Leben. Dazu tragen auch die Schwarz-Weiß-Fotos von Kurt Hörbst bei, sie kräftigen die Erdung und viele seiner Momentaufnahmen wirken wie Stillleben. Ein Buch, das leise und liebenswert den Mythos Alm wach hält.
(Claudia Theiner, Rezension in den Dolomiten vom [?.] August 2009)