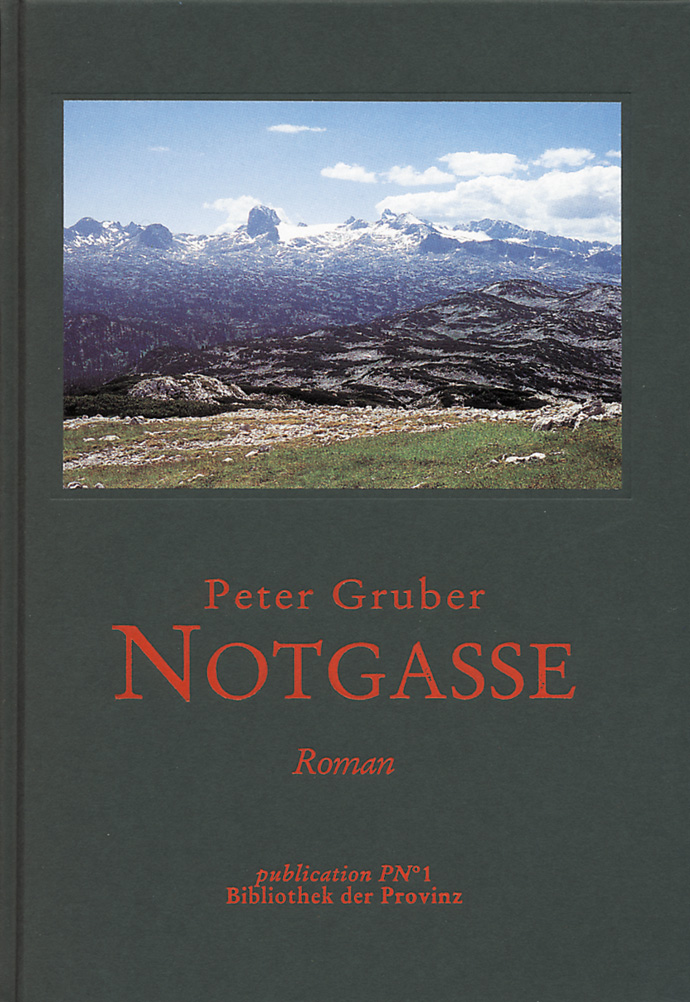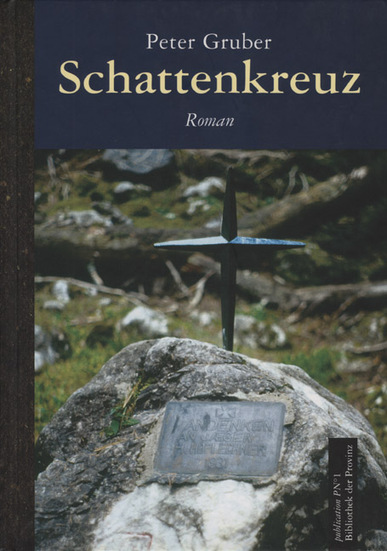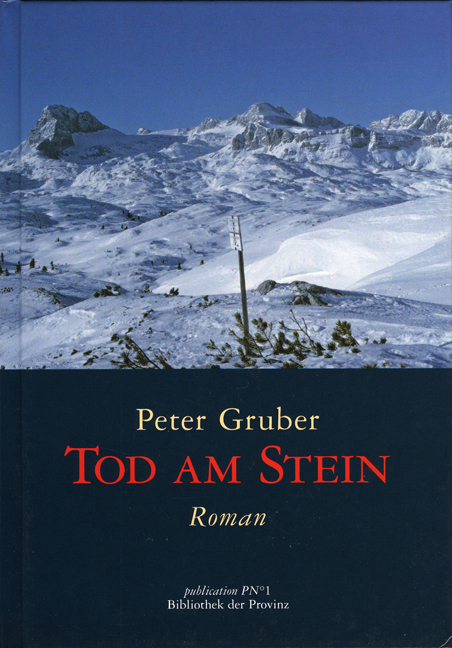
Tod am Stein
Roman
Peter Gruber
ISBN: 978-3-85252-729-1
21×15 cm, 408 Seiten, Hardcover
34,00 €
Momentan nicht lieferbar
Kurzbeschreibung
Eines der dunkelsten und dramatischsten Kapitel in der Geschichte des Dachsteingebirges wurde zu Ostern 1954 geschrieben, auf der Karsthochfläche AM STEIN, die im Sommer so sehr archaisch und mystisch anmutet und im Winter einer Schneewüste gleicht. Es war ein Gründonnerstag, als Lehrer und Schüler aus Heilbronn/Deutschland von Obertraun im Salzkammergut auf den Krippenstein aufbrachen. Zehn Jungen im Alter zwischen 14 bis 17 Jahren, voll sprühender Jugendlichkeit, ein junges Lehrerpaar, alle hoch motiviert, von sportlichem Ehrgeiz und von der Faszination der Bergwelt angetrieben, geführt von einem natur- und bergerfahrenen Klassenlehrer.
»Der Dachstein ruft«, wiederholte Hans Jörg Wolf, lauter und deutlicher als zuvor, wandte sich vom weit offen stehenden Fenster ab, trat einen Schritt zurück und überblickte die Reihen der Schüler. Seitlich einfallendes Frühlingslicht ließ den dunklen Anzug des Klassenlehrers einen Moment lang schraffiert erscheinen. Die launische Aprilluft, die schon den ganzen Vormittag über eine Brise um die andere in das Klassenzimmer der 5a geschickt hatte, erweckte den Anschein, sie würde den soeben erklungenen Ruf des Dachsteins in jeden Winkel des Raumes tragen wollen. Vom Lehrer zu den Schülern, von Jungen zu Jungen, von der Tafel zu den an den Seitenwänden angesteckten bunten Wachskreidezeichnungen, von den leicht geneigten Doppelschulbänken zu den beiden an der Rückwand des Klassenzimmers aufgehängten Landkarten. Eine davon gab die politische Staatenstruktur Europas wieder, die andere den quer über Mitteleuropa liegenden Alpenbogen mit weiß betonten Gletscherflächen. Diese physische Karte wies gegen den rechten Bogenauslauf hin ein angestecktes Fähnchen auf, das auf den Punkt genau die östlichsten Gletscher der Alpen kennzeichnete, die des Dachsteingebirges.
Die Schüler der Knabenmittelschule Heilbronn, denen Wolf das vorzeitige Ende des Unterrichtes verkündet hatte, um über die bevorstehende Dachsteinfahrt zu sprechen, hielten im Zusammenklappen ihrer Schulhefte und Bücher inne. Sie schauten neugierig zu ihrem Klassenlehrer. In wenigen Minuten würde die Biologiestunde zu Ende sein und die Osterferien würden beginnen.
»In zwei Tagen, am Sonntagabend, werden wir der Majestät Dachstein zu Füßen sein. Ihr werdet der Welt der Berge begegnen, wie ihr es euch in den abenteuerlichsten Träumen nicht vorstellen könnt. Es werden die schönsten Ferien werden, die ihr jemals erlebt habt. Das verspreche ich euch«, sagte Hans Jörg Wolf zu den Jungen, die gebannt ihrem Lehrer zuhörten.
»Vergesst nicht, noch einmal einen genauen Blick auf die Gepäcksliste zu werfen, die ihr bekommen habt«, fuhr der Lehrer fort, während er an den Katheder herantrat.
»Anorak, Fäustlinge, Wollhaube. In den Bergen kann es um diese Jahreszeit noch stark abkühlen, vor allem nachts. Da darf es an warmer, guter Kleidung nicht fehlen. Brotbeutel nicht vergessen! Taschenmesser mitnehmen! Sonnenbrillen können nützlich sein. Wenn es Fragen gibt …«
»Ja, Herr Wolf! Werden wir den Dachstein besteigen? Der soll ja dreitausend Meter hoch sein«, wollte Michael Lahner, der begabteste Leichtathlet der Schule, wissen.
»Fünf Meter fehlen auf die Dreitausend«, antwortete Wolf dem Jungen. »Der Dachstein selbst wird eine Nummer zu groß für uns sein. Ich nehme an, dass dort oben jetzt noch viel Schnee liegt, auch Eis. Die Gletscher reichen bis zum Gipfeleinstieg hinauf.«
»Tiefe Spalten im Eis? Aus denen man nie wieder herauskommt, wenn man hineinstürzt?« Egon Schwarz, einer der Jüngeren, klang besorgt.
»Nein, nein«, beruhigte der Lehrer augenblicklich. »Wir werden selbstverständlich keine Gefahren herausfordern! Das heißt, wir werden nicht über Gletscherspalten steigen. Das Dachsteingebirge ist unendlich weit. In diesem Gebirgsmassiv gibt es dutzende Gipfel, die fernab der Gletscher liegen und wunderbare Ausblicke bieten. Einige Gipfeltouren werden wir schon unternehmen. Aber erst, nachdem wir uns eingewandert haben«.
»Gibt es am Dachstein Felswände zum Klettern?«, fragte Ulrich Störr, Redakteur der Schülerzeitung. Er war noch nie zuvor in den Bergen gewesen. […]
Rezensionen
Martin Kubaczek: [Rezension]Katastrophenliteratur hat wohl mit Katharsis zu tun; aber auch damit, den Opfern eine Stimme zu geben. In Fall von Peter Grubers Roman ermöglicht sie, eine Tragödie nach fünf Jahrzehnten zu befrieden, indem sie erzählerisch aufbereitet und so auch abgeschlossen wird.
Gruber, literarischer Chronist des Dachsteingebiets, arbeitet einen alpinen Unglücksfall auf, der Spuren in der Nachkriegsgeschichte hinterlassen hat: In der Karwoche 1953 befindet sich eine Schulklasse aus der deutschen Kleinstadt Heilbronn auf Bergurlaub in Obertraun. Der ambitionierte Lehrer, gebürtiger Südtiroler, riskiert trotz Schlechtwetters und mehrerer Warnungen von Einheimischen einen langen Aufstieg von der Nordseite des Bergmassivs. Die Gruppe von zehn Schülern und drei Lehren verliert im Schneesturm im Karstgelände die Orientierung, errichtet ein notdürftiges Biwak. Die bis dahin zusammenhaltende Gruppe bricht in der Nacht auseinander, eine großangelegte Suche im Schlechtwetter bleibt über Tage hin ergebnislos, das Unglück wird zur Gewissheit, die letzten beiden Vermissten werden erst im Frühjahr gefunden.
Gruber beschreibt minutiös das Geschehen: Innerhalb eines genau abgesteckten Zeitraums baut sich die Katastrophe auf, mit einem Vorlauf, der die Personen noch außerhalb des Dramenraums im Schulalltag in Heilbronn zeigt. Der Vergleich mit einem Dokumentarband zu den Ereignissen zeigt, dass sich Gruber zwar so eng wie möglich an den Fakten entlang bewegt, dazwischen aber das emotionale Terrain der Beteiligten auffüllt mit der Nachimagination, wie es gewesen sein könnte. Um seine Figuren zu schützen, verändert er sämtliche Namen von Schülern, Lehrern, Bergrettern und Beteiligten. Dies eröffnet ihm erst die Möglichkeit der Vorstellungsarbeit, mit der die erzählerische Rekonstruktion als eine Synthese von Dokument und Fiktion versucht wird.
Oft werden die Situationen dabei dialogisch aufbereitet, sie vermitteln sich über die Gedankenketten und Sätze der Figuren, etwa in den Apellen des Lehrers, in Streit- und Angstgesprächen, oder in Beschreibungen der physischen Erfahrung von Unterkühlung bis hin zur völligen Erschöpfung, die von letzten Panikattacken unterbrochen wird. Noch dominieren autoritäre Diskurse einer Männergesellschaft, Frauen haben kaum Gewicht und Stimme, die kriegerische Metaphorik des Alpinismus ist deutlich präsent. Gruber benützt trivialliterarische Modelle mit ihren Typen und Archaismen, manchmal wirken die Dialoge gekünstelt und überdramatisiert. Problematisch sind die mythischen und naturmagischen Darstellungen, wenn der Autor nicht auf die unmittelbare Erfahrung vertraut, sondern eine primär unmenschliche Natur in einer anthropomorphen Metaphorik präsentiert: da fletscht der Sturm die Zähne, zeigt der Berg sein furchtbares Antlitz, gerät die Wilde Jagd der Geister in nächtliche Raserei, wird das präzise beschreibbare Naturphänomen zum raunend metaphysischen Subjekt.
Die Stärken der Erzählung liegen in Einfühlung und Nachempfinden auf der Basis von Recherche, Expertise und Eigenerfahrung. Gruber hält mittels erzählerischer Gegenschnitte, in denen die Schauplätze abwechselnd gezeigt werden, die Spannung, bemüht sich um Einsicht in die Aktionsweisen der Beteiligten, sowohl auf Seiten der Suchenden wie der Verirrten. Der Perspektivenwechsel zwischen Tal und Berg wird in zwei gegenläufigen und in ihren Namen mythologisch überhöhten Protagonisten repräsentiert: Zorn, der abweisende Verwalter, der die Institution vertritt, und Wolf, der engagierte Lehrer, der den Verwalter falsch informiert und heimlich eine ambitioniertere Route wählt. Bei dramatischer Wetterverschlechterung und entgegen dezidierter Warnungen lässt er seine Gruppe weiter aufsteigen. Das eigentliche Drama entwickelt sich dann im Verlust der Orientierung und im Zerfall der Kooperation der Gruppe.
Dazwischen erweist sich die Tragödie als öffentliche Krise der Nachkriegszeit: Die Zweite Republik befindet sich mitten im Aufbau von Seilbahnen und Imagekorrektur für den Tourismus; die mediale Präsenz des modernen Sensationsjournalismus ermöglicht die emotionale Beteiligung am Verlauf des Dramas. Die bald aussichtslose Suche (mit bis zu 500 Alpingendarmen und Bergrettern) wird zur Staatskrise, Politiker reisen an, Zuständigkeiten und Rechte unter der amerikanischen Besatzung sind teilweise ungeklärt, die Suchaktionen anfangs unkoordiniert: ein Hubschrauber landet im Nebel unten im Tal, kann aber nicht aufsteigen, zwei Militärflugzeuge überfliegen in großer Höhe das Gebiet. Die Bergretter bleiben bei Schlechtwetter auf sich gestellt, finden sich Vorwürfen und Kritik ausgesetzt.
In Geschichte wie Dramaturgie finden sich motivische Parallelen zu Stifters Erzählung „Bergkristall“: Während beide Texte ein winterliches Verirren am Dachstein nachvollziehen, läuten bei Stifter am Ende die Glocken in den umliegenden Dörfern, um den am Berg Suchenden das Auffinden der verlorenen Geschwister anzuzeigen, sie verkünden so eine wunderbare Errettung zu Weihnacht. In Grubers Roman dagegen läuten die Totenglocken, die sonst nur am Jahrestag des britischen Bombardements der Stadt zu hören sind, in das österliche Auferstehungsfest hinein. „Der Tod ist der Unwert an sich“, schrieb Hermann Broch; an die Stelle solcher Wertungen setzt Gruber sein behutsames Begleiten, er fügt perspektivisch die aufgesplitterten Erinnerungen, gibt Vermutungen über Ursachen und Verlauf der Katastrophe in ihren Raum. Interessanterweise ist es nicht der Dokumentenband, der die Ungewissheit abschließt, sondern die Erzählung, der fiktionale Text: In ihm verleiht Gruber den Opfern Sprache, erlöst sie von ihren Rätseln.
(Martin Kubaczek, Rezension im Buchmagazin des Literaturhaus Wien, online veröffentlicht am 3. März 2009)
https://www.literaturhaus-wien.at/review/tod-am-stein/