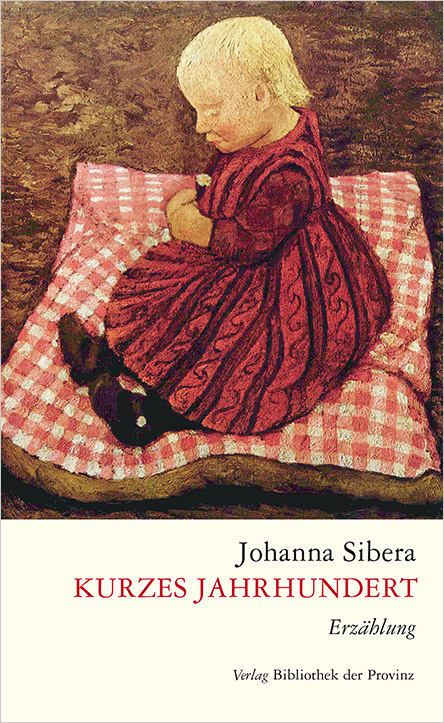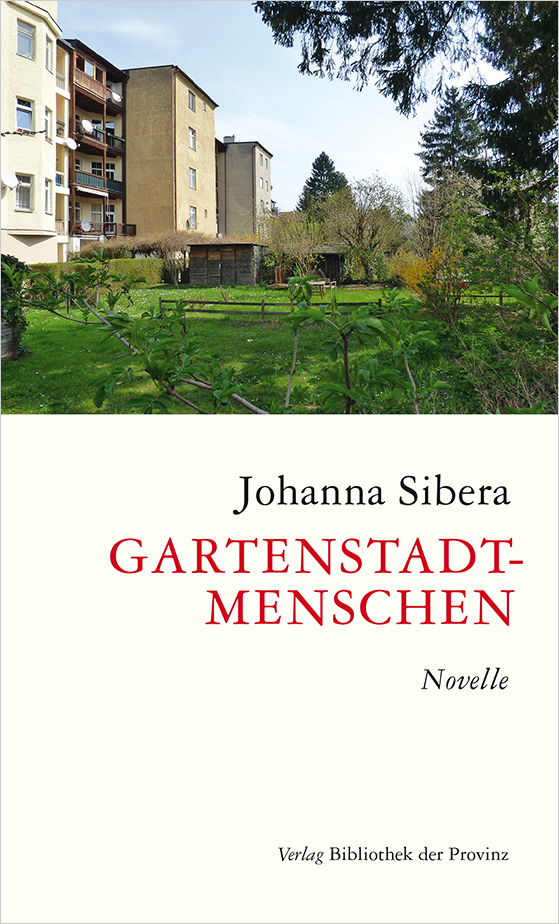
Gartenstadtmenschen
Novelle
Johanna Sibera
ISBN: 978-3-99028-473-5
19 x 12 cm, 86 S., Broschur
10,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
In der Gartenstadt die Idealfamilie: Vater, Mutter und Kinder.
So eine ideale Familie und ein echter Gewinn für die Gemeinschaft von Nummer einunddreißig war das Ehepaar, das Mitte der Fünfziger Jahre die ebenerdig gelegene Hausbesorgerwohnung bezogen hatte. Tüchtige junge Leute waren das, die adrette rundliche Hilde Gerstl und ihr Mann Christian, ein Tischler. Ein Bub – beim Einzug der drei noch im Vorschulalter – komplettierte die Familie. Ein vifes Kind war dieser kleine Leopold, das sagten bald alle Parteien. Und eine wunderbare Hausmeisterin war Hilde Gerstl, die es zustande brachte, dem grauen engen aufzuglosen Stiegenhaus dauerhafte Reinlichkeit, ja fast so etwas wie Glanz zu verleihen. Keiner, der Haus Nr. 31 betrat oder verließ, entging ihren so sanft wirkenden blauen Augen. Und später dann, zu der Zeit, als Bertram begann, abends aus zu gehen, profitierte er von ihrer Güte, immer wieder vergaß oder verlor er seinen Haustorschlüssel und Frau Gerstl öffnete ihm zu nächtlicher Stunde die Türe, für die es eine fixe Sperrstunde gab. Aus diesen Tagen stammte auch Julian Kohns stereotype Frage an seinen Sohn: „Hast du Gerstl für die Gerstl?“ Aber Hilde Gerstl wollte eigentlich nie etwas nehmen für ihre Gefälligkeit.
Viele Jahrzehnte lebte das Ehepaar in der Gartenstadt, auch als sie ihrer Hausmeistertätigkeit aus Altersgründen nicht mehr nachgingen. Heute gibt es die typisch österreichischen Hausbesorger in diesem Sinne nicht mehr; sie heißen nun Hausbetreuer und unterliegen völlig anderen Richtlinien.
Manfred und Beate bildeten ein wenig die Ausnahme vom gängigen Familienmodell, denn die beiden hausten nicht mit ihren Eltern oder zumindest ihrer Mutter in einer Wohnung, wie das so üblich war, sondern bei ihrer Großmutter, der Frau Weyrich. Die Mutter der Kinder, allgemein als die „schöne Gerda“ bezeichnet, lebte aus nicht nachvollziehbaren Gründen im italienischen Grado und kam, selten genug, auf Kurzbesuch. Genauer gesagt, konnte sich niemand richtig erinnern, wann sie das letzte Mal da gewesen war, meistens hatte nur irgend jemand von jemand anderem gehört, dass sie auf einen Sprung vorbei gekommen war, um ihre Kinder zu küssen, aber so nachweisbar genau wusste das keiner.
Rezensionen
EB: Johanna Sibera, „Gartenstadtmenschen“Andre mögen dicke Wälzer mit Hunderten Seiten an Familiengeschichten füllen, wie sie derzeit am Buchmarkt en vogue zu sein scheinen. Der Kritzendorfer Autorin Johanna Sibera gelingt hingegen in ihrem schlicht als Novelle bezeichneten Band „Gartenstadtmenschen“ das Kunststück, jede Menge Schicksale und Begebenheiten in einer Klosterneuburger Gartensiedlung über Jahrzehnte hinweg auf gerade einmal 84 Seiten zu komprimieren und dabei aber so anschaulich darzustellen, dass man als Leser vermeint, all diese Menschen selbst noch gekannt und auch die Atmosphäre der längst vergangenen Tage noch verspürt zu haben.
Knapp nach dem Ersten Weltkrieg brachte der soziale Wohnbau in Klosterneuburg diese Gartenstadt hervor. Wohnungen mit Balkon und sogar mit einem Stückchen Grün, vor allem für die Kinder. Die unterschiedlichsten Leute leben in der Gartenstadt, und unterschiedlich ist der Gebrauch, den sie von ihren Gärten und Wohnungen machen. Ein alter Professor spielt seiner Schwiegertochter, Kinder spielen mit Murmeln, ein sonnengebräunter Hausverwalter spielt mit den Kindern. Doch hinter scheinbaren Idyllen lauern immer auch die unerwarteten Untiefen. Es wird gelebt, geliebt, gelitten, und all dies wird so selbstverständlich, uneitel, unbetulich und zugleich überaus einfühlsam beschrieben. Da wird trotz gelegentlicher Ironie niemand desavouiert, niemand lächerlich gemacht, allen belässt Sibera ihre Würde. Ein kleines Meisterstück.
Die Gartenstadt gibt es natürlich wirklich, Kundige finden bald heraus, wo sie zu orten ist.
(EB, Rezension in der NÖN vom [?.] November 2015, S. 19)
Ewald Baringer: „Es ist ja alles de facto passiert“
Im NÖN-Gespräch | Johanna Sibera über ihr Buch „Gartenstadtmenschen“ und die Reaktionen darauf.
Mit ihrer in der Bibliothek der Provinz erschienenen Novelle „Gartenstadtmenschen“ – Reminiszenzen an die reale Gartenstadt-Siedlung in Klosterneuburg – hat die Schriftstellerin Johanna Sibera eine bemerkenswerte Veröffentlichung vorgelegt. Im NÖN-Gespräch erzählt sie über das Buch (…).
NÖN: Bekommen Sie viele Rückmeldungen auf Ihr Buch?
Sibera: Ja, immer wieder. Auch beim Einkaufen. Viele Menschen fragen sogar: „Warum komme ich nicht vor?“ Dabei hatte ich beim Schreiben das Problem: Nenne ich die Personen beim Namen? Ich arbeite jetzt an einer Fortsetzung mit dem Arbeitstitel „Die Straße nach Kierling“.
Wie sind Sie darauf gekommen, diese Geschichte zu schreiben?
Sibera: Es ist ja alles de facto passiert, worüber ich geschrieben habe. Am Anfang stand die ebenfalls reale Begebenheit eines Missbrauchs. Mitte der 50er-Jahre hat man eben als Kind einem Erwachsenen nicht widersprochen. Und so entsteht rund um die Ausgangsgeschichte ein Gerüst, an dem dann weitergearbeitet wird.
Was hat Sie überhaupt zum Schreiben gebracht?
Sibera: Schon in der Schulzeit bin ich durch meine Aufsätze positiv aufgefallen. Später hat mich in der Anwaltskanzlei, wo ich beruflich tätig war, das Handwerkliche in der damals aufkommenden PC-Textverarbeitung fasziniert. Dann habe ich eines Tages eine Kurzgeschichte im Feuilletonteil einer Tageszeitung veröffentlicht. Es folgten Lyrik, Prosa. Irgendwo habe ich im Internet gelesen: Johanna Sibera lebt und arbeitet in Nordrhein/Westfalen.
Das ist sicher nicht der Fall. Zumal Sie ja auch – nicht zuletzt in Form von Leserbriefen – intensiv am Leben in Klosterneuburg Anteil nehmen.
Sibera: Ich verstehe mich gewissermaßen auch als „Grätzelschreiberin“. Auch mein Bruder [Anm.: Jürgen Weil (…)] ist sehr verbunden mit Klosterneuburg, obwohl er in Wien lebt. Seine Schulzeit ist für ihn immer noch sehr wichtig, er ist gleichsam ein „ewiger Schüler.“
(Ewald Baringer im Gespräch mit Johanna Sibera, erschienen in der NÖN vom 15. April 2016, S. 20)