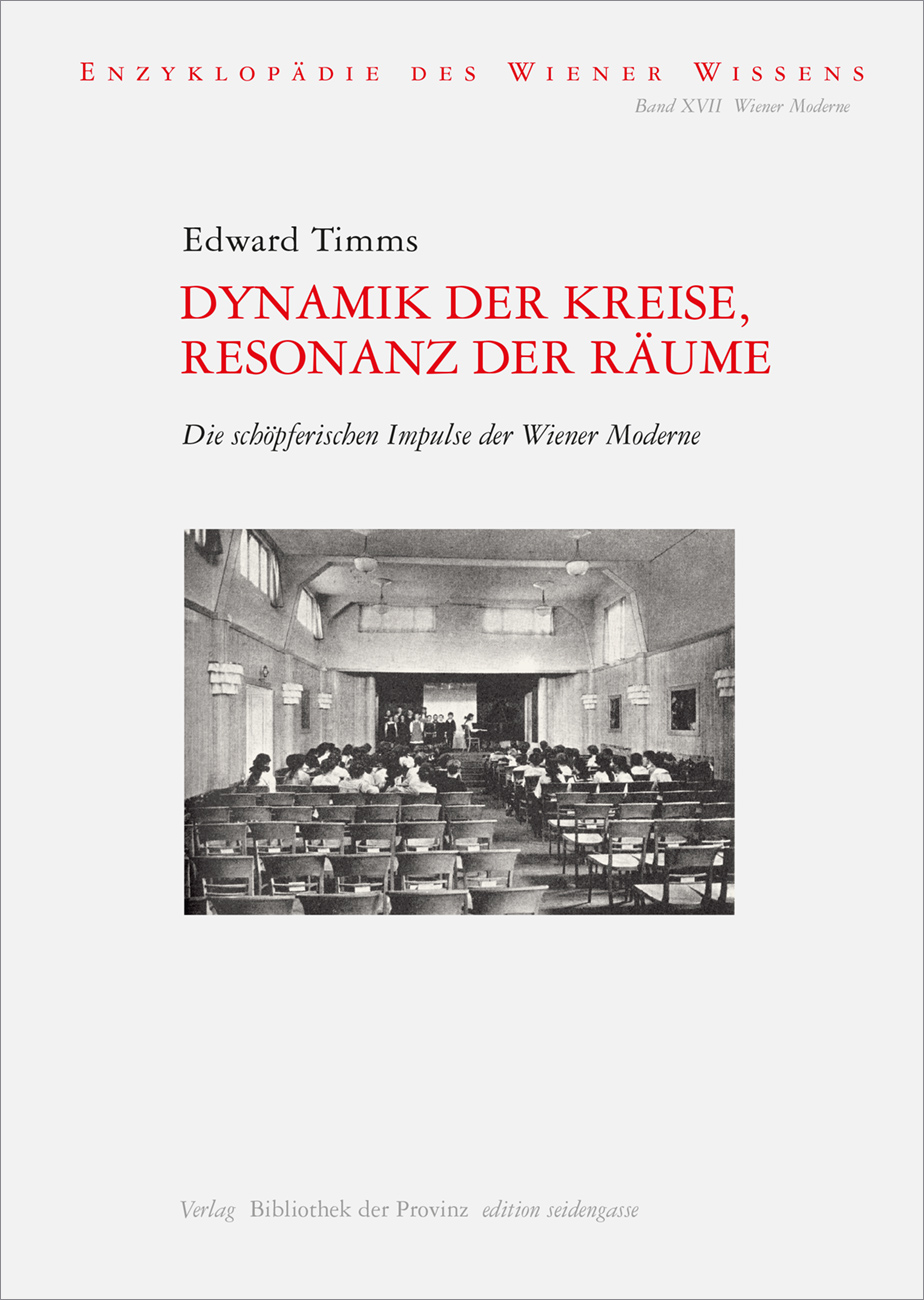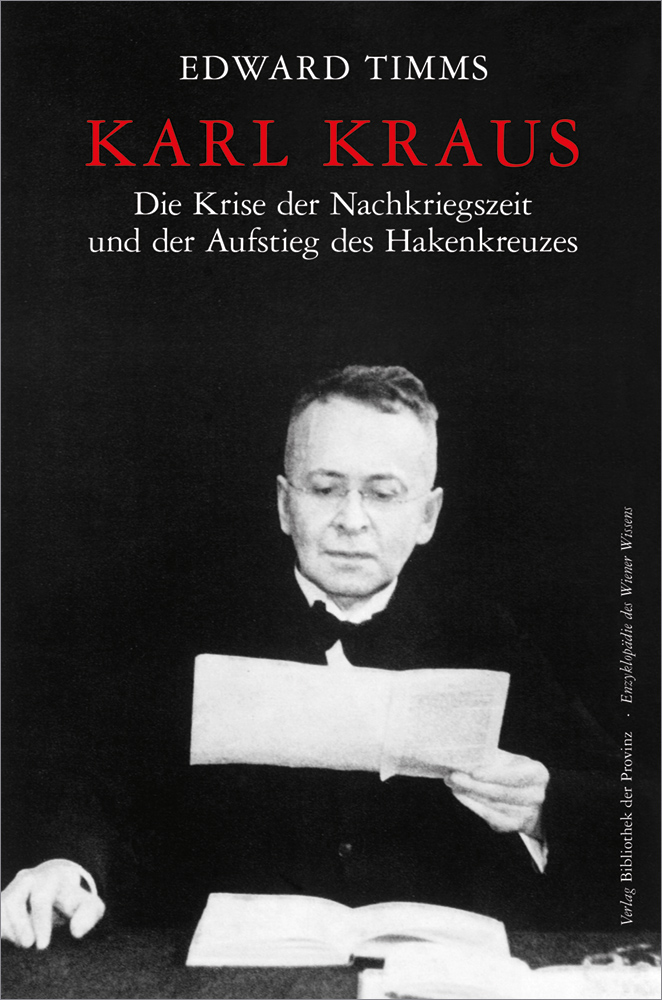
Karl Kraus – Die Krise der Nachkriegszeit und der Aufstieg des Hakenkreuzes
Edward Timms, Karl Kraus
edition seidengasse: Enzyklopädie des Wiener Wissens: PortraitsISBN: 978-3-99028-499-5
24×16 cm, 688 Seiten, m. Abb., Kt., Notenbeisp., Hardcover
48,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
Anschließend an „Karl Kraus – Satiriker der Apokalypse: Leben und Werk 1874–1918“ stellt Edward Timms in diesem Band anhand präziser Detailanalysen, pointierter Zitate und weitblickender Kontextualisierungen dar, wie der Satiriker den turbulenten Entwicklungen der Zwischenkriegszeit begegnet ist.
Kraus’ Zeitschrift Die Fackel dient dabei als unentbehrlicher Führer durch die Kulturpolitik dieser Zeit. Seine größten Polemiken der 1920er Jahre werden in einem zentralen Abschnitt mit dem Kapitel ‚Verteidigung der Republik‘ analysiert, der seine zwiespältige Allianz mit den Sozialdemokraten wie auch seine Konfrontationen mit dem konservativen Kanzler Ignaz Seipel und dem Wiener Polizeipräsidenten Johann Schober hervorhebt. Die Legende, dass Kraus Hitlers Machtergreifung mit Schweigen beantwortet habe, wird abschließend definitiv widerlegt. Schon wesentlich früher hatte er vor dem Aufstieg des Hakenkreuzes gewarnt, und mit der 1933 entworfenen Polemik „Dritte Walpurgisnacht“ hinterließ Kraus eine stichhaltige Analyse des heraufziehenden Nationalsozialismus.
Dieses Buch ist kein Porträt eines isolierten Einzelkämpfers, sondern zeigt Kraus als Schlüsselfigur innerhalb eines komplexen und umstrittenen Feldes der kulturellen Produktion. Auf den Zusammenbruch der Habsburgermonarchie und die Gründung der Republik reagierte er mit einer Art trotzigen Hoffnung. Er identifizierte sich mit dem Reformprogramm der Sozialdemokraten in Wien und fand wertvolle Verbündete in Friedrich Austerlitz, Chefredakteur der Arbeiter-Zeitung, und David Josef Bach, Leiter der Kunststelle. Da er die Grundsätze internationalen Rechts als Schutz vor der zweifachen Bedrohung durch reaktionäre Politik und unverantwortliche Medien auffasste, widmete er sich dem Kampf um dessen Durchsetzung, unterstützt durch seinen unermüdlichen Anwalt Oskar Samek.
Um seine Polemik gegen unverantwortliche Politiker und korrupte Journalisten zu kontextualisieren, skizziert das Buch die österreichische Zeitungslandschaft und den Kampf zwischen den konkurrierenden ideologischen Lagern. Zielscheiben von Kraus’ Medienkritik waren vor allem die chauvinistische Haltung der von Friedrich Funder geleiteten Reichspost und der skandalsüchtige Boulevardjournalismus, angeführt von Békessy und Die Stunde.
Die Quellen, aus denen Kraus seine wertvollste Inspiration bezog, werden bis zu seinem Konzept des ‚schöpferischen Ursprungs‘ zurückverfolgt. Hier geht es, vor allem in seiner Lyrik, um die Beschwörung von Kindheitserinnerungen, heiligen Landschaften und emotionalen Bindungen zu begabten Frauen, von Sidonie Nádherný in Janowitz zu Mechtilde Lichnowsky in Berlin. Durch seine Offenbach-Bearbeitungen mischte Kraus auch in der Musikszene mit und fand Anhänger unter Mitgliedern der Zweiten Wiener Schule, vor allem Alban Berg und Anton Webern, später auch Ernst Krenek. Die Enttäuschung über die zunehmend autoritären Tendenzen in Deutschland und Österreich veranlasste ihn dazu, seine Schaffenskraft der Neubelebung von Dramen Shakespeares und Goethes, Nestroys und Gogols zu widmen, die er in sein Vorlesungsprogramm aufnahm.
Als die Krisensituation in der europäischen Politik sich zuspitzte, unterstützte Kraus das Dollfuß-Regime nicht nur als ein ‚kleineres Übel‘, sondern als den Versuch, ein unabhängiges und stabiles Regierungssystem aufrechtzuerhalten. In Dritte Walpurgisnacht, seiner messerscharfen Analyse des Nationalsozialismus, entwickelte er neue Formen der intertextuellen Satire, die das Deutschland Hitlers und Goebbels’ mit Motiven aus Goethes Faust kontrastiert. Als Kraus letztlich verstummte, reagierte der mit ihm befreundete Bert Brecht mit dem Ausspruch: ‚Als das Zeitalter Hand an sich legte, war er jene Hand.‘
[Enzyklopädisches Stichwort]
[edition seidengasse · Enzyklopädie des Wiener Wissens · Porträts, Bd. V |
Begründet 2003 u. hrsg. von Hubert Christian Ehalt für die Wiener Vorlesungen, Dialogforum der Stadt Wien]
[Übers. aus d. Englischen von Brigitte Stocker]
Rezensionen
Helmut Mayer: Der im Haus der Sprache wohnteDem Satiriker der Apokalypse fiel zu Hitler ziemlich viel ein: Der zweite Band von Edward Timms’ großer Studie zu Karl Kraus liegt nun endlich auch auf Deutsch vor.
Einer der bedeutendsten Texte zur Machtergreifung der Nationalsozialisten trägt den Titel „Dritte Walpurgisnacht“. Geschrieben hat ihn Karl Kraus in Wien zwischen Mai und September 1933. Er war zum großen Teil bereits gesetzt, als Kraus sich entschloss, dieses über dreihundert Seiten umfassende Heft der „Fackel“ nicht zu veröffentlichen. Stattdessen erschien im Oktober ein schmales „Fackel“-Heft, das lediglich die Rede am Grab des Freundes Adolf Loos enthielt sowie ein zehnzeiliges Gedicht. Als einziges von Kraus’ Gedichten trägt es keinen Titel. „Man frage nicht, was all die Zeit ich machte. / Ich bleibe stumm“, so hebt es an, und es schließt: „Das Wort entschlief, als jene Welt erwachte.“
Bert Brecht, bereits im Exil in Dänemark, wusste diese Zeilen von Kraus, den er noch im März in Wien getroffen hatte, zu lesen: als Zeugnis in extremis des Satirikers, der sich Hitler und seiner Bewegung als Produkt einer vergifteten Nachkriegsgesellschaft seit den frühen zwanziger Jahren in der „Fackel“ immer wieder gewidmet hatte. Der Tenor linker Verehrer der „Fackel“ nahm sich anders aus. Sein Schweigen wurde Kraus als Verrat am gerade jetzt notwendigen Kampf, wenn nicht gleich als Eingeständnis der Feigheit ausgelegt. Kraus reagierte darauf erst Juli 1934.
Mitte Juli erschien noch einmal ein schmales „Fackel“-Heft, das die Vor- und Anwürfe unter dem Titel „Nachrufe auf Karl Kraus“ versammelte, Ende des Monats eine Ausgabe von mehr als dreihundert Seiten – nicht weniger furios als die der Nachwelt aufbehaltene „Walpurgisnacht“ –, in der Kraus unter dem Titel „Warum die Fackel nicht erscheint“ mit allen hochtönenden linken Forderungen abrechnet, sich für den „Kampf“ politisch einzureihen, und sein heftig kritisiertes Eintreten für den österreichischen Ständestaat als letzte Bastion gegen Hitler rechtfertigt, als Rettung „vor dem entsetzlichsten Verhängnis, das jemals über der Menschheit gelastet hat“. Bitterer noch tat er es dann im letzten Text des letzten Hefts der „Fackel“ vom Februar 1936, wenige Monate vor seinem Tod, in der er den enttäuschten, Kampfparolen und Stellungnahmen fordernden linken Verehrern vorhält, von seinem Lebenswerk offensichtlich nichts verstanden zu haben: „Größer als der Schmerz, den Anhang verloren zu haben, ist die Scham, ihn besessen zu haben.“
Wer sich von Verlauf und Hintergrund dieser Auseinandersetzungen ein halbwegs detailliertes Bild machen will, der kann seit einigen Jahren zum zweiten Band der großen Darstellung greifen, die der englische Germanist und Kulturwissenschaftler Edward Timms Karl Kraus gewidmet hat (F.A.Z. vom 17. Juni). 1986 war ihr erster Band auf Englisch erschienen, der neun Jahre später auch auf Deutsch herauskam. 2005 legte Timms dann den zweiten stattlichen Band vor, der vom Ende des Weltkriegs und den noch im ersten Band behandelten „Letzten Tagen der Menschheit“ bis zum letzten „Fackel“-Heft reicht. Jetzt konnte auch er auf Deutsch erscheinen, weil die darob sehr zu lobende Kulturabteilung der Stadt Wien Sukkurs gab, um endlich den Missstand zu beheben, dass die einzige umfassende Darstellung des Autors Kraus im Kontext seiner Zeit zur Hälfte unübersetzt geblieben war.
Timms hat mit den insgesamt über tausendzweihundert Seiten von „Karl Kraus – Apocalyptic Satirist“ (der deutsche Titel tilgt den Apokalyptiker) keine Biographie üblichen Zuschnitts geschrieben, denn der private Kraus ist weitgehend beiseitegelassen. Alles ist konzentriert auf die Texte von Kraus, die Timms in Grundzügen referiert und mit einer überaus reichhaltigen, oft weit in die allgemeinen politischen und kulturellen Verhältnisse ausgreifenden Kommentierung versieht.
Mit Blick auf die letzten Lebensjahre von Kraus bedeutet das für den Leser unter anderem, gründliche Erläuterungen zu den politischen Bewegungen sowohl in Deutschland wie in Österreich zu erhalten, um vor diesem Hintergrund Kraus’ Eintreten für Dollfuß’ autoritären Staat und sein hartes Gericht über die Sozialdemokratie als Partei des falschen Taktierens und der Phrasen einschätzen zu können. Wobei dieses Gericht nicht bedeutete, wie immer noch manchmal zu lesen ist, dass der späte Kraus politisch einfach die Seiten gewechselt hätte und nach seiner Annäherung an die Sozialdemokratie in den zwanziger Jahren zum Reaktionär geworden wäre. Schließlich störte Kraus nicht, dass die Sozialdemokratie klassenkämpferisch die Sache der Arbeiter vertrat, sondern dass sie diese Sache verraten habe, indem sie gegen Hitler nicht zur Stelle war.
Auch mit dem Schreckgespenst des Kommunismus war Kraus nicht in Verlegenheit zu bringen. „Der Teufel hole seine Praxis“, schrieb er Anfang der zwanziger Jahre, „aber Gott erhalte ihn uns als konstante Drohung über den Häuptern jener, so da Güter besitzen und alle anderen zu deren Bewahrung und mit dem Trost, dass das Leben der Güter höchstes nicht sei, an die Fronten des Hungers und der vaterländischen Ehre treiben möchten.“
Bei Timms kann man über die großen und kleinen Attacken der „Fackel“ hinweg gut verfolgen, wie das immer zwiespältig bleibende Verhältnis von Kraus zur Sozialdemokratie sich einspielte, gestützt von seinen Angriffen auf Christlichsoziale wie Schober und Seipel, bevor es mit Furor als Missverständnis aufgekündigt wurde. Nicht ohne Erinnerung von Kraus’ Seite (in der letzten seiner zahlreichen Prozessvorlagen), dass er schließlich nie ein Anhänger der Demokratie als oberstem politischen Wert gewesen sei und – das zielte auf das gern emphatisch geschwungene Banner der „Freiheit“ – „den liberalen Standpunkt in der Politik, im Wirtschaftsleben und in der Meinungsäußerung ablehne“.
Es war die Erinnerung daran, dass er mit seiner Kritik immer an tiefer liegende Wurzeln gegriffen hatte, als parteipolitische Vereinnahmung einräumen konnte, sichtbar gemacht in den Sprachregimes, die er ihrer gar nicht verborgenen Wahrheiten überführte.
Der am häufigsten zitierte Satz der „Walpurgisnacht“, der zusammen mit anderen Abschnitten auch in das zweite „Fackel“-Heft vom Juli 1934 einging, ist wohl immer noch dieser: „Mir fällt zu Hitler nichts ein.“ Auf den ersten Blick scheint er eine Variante dessen, was der von Kraus nicht geschätzte Tucholsky im Sinn hatte, als er mit Blick auf Hitler schrieb, so tief könne man, also der Satiriker, gar nicht schießen. Doch bei Kraus ist dieser Satz, der darauf zielt, dass angesichts der hemmungslos gewordenen Gewalt, die keine offene Lüge mehr scheut, die Appellationsinstanzen des Satirikers zerfallen, gerade der Auftakt zu einem furiosen Pandämonium, das lesen sollte, wer darüber urteilen möchte, was sich 1933 alles wissen ließ, wenn man es nur wissen wollte. Oder der etwa die satirische Kunst kennenlernen möchte, Literaten und Intellektuelle in Aufbruchsstimmung zu überführen, sei’s Gottfried Benn oder Martin Heidegger.
Auch das kann man bei Timms nachlesen, der sich sogar unerschrocken an eine Inhaltsangabe der „Walpurgisnacht“, dieses „Irrgartens tausendfacher Antithetik“ (Kraus), macht. Das gerät zwar bieder, wie überhaupt festzuhalten ist, dass man bei Timms nicht mit sprühendem Geist rechnen darf, dafür aber mit nüchtern präsentierten Erläuterungen, Synopsen und Verknüpfungen. Von einer gewissen akademischen Behäbigkeit reißt er sich dabei nicht los, und es gibt Sätze und Passagen, bei denen die Geduld geprüft wird – aber dann doch einen Absatz weiter meist die Belohnung durch Hinweise und Zitate, die man sich aus der zerstreuten Kraus-Literatur mühsam heraussuchen müsste, wenn man sie dort denn überhaupt fände.
Als Kraus-Leser kann man an dem nüchternen Timms, der trotz jahrelanger Beschäftigung mit Kraus der Hagiographie absolut unverdächtig ist – so sehr, dass es passionierte Leser von Kraus vielleicht sogar irritiert –, nicht vorbeigehen. Selbst wenn seine Darstellung den Sprachkünstler Kraus notgedrungen eher umkreist als zu erkennen gibt. Die Lektüre von Kraus soll sie ja auch nicht ersetzen, zumindest nicht bei deutschsprachigen Lesern, und für sie muss man die Realien der Zeitkritik, so aufschlussreich sie auch sind, auch wieder vergessen können, so wie das Kraus selbst für seinen Nachruhm in Anspruch nahm.
Die Übersetzung hat selbstredend den großen Vorteil, die Zitate von Kraus, aber auch von vielen anderen Autoren im originalen Wortlaut zu geben. Doch sie leistet sich Patzer. Das beginnt schon im ersten Absatz des Vorworts, wo man erstaunt liest, der Autor habe einmal versucht, Kraus’ Philosophie der Sprache „zu definieren“. Man schlägt im Original nach und ist beruhigt: „to come to terms with Kraus’s philosophy of language“ steht da. Ein paar Seiten weiter ist es dann schwer, die faschistische Bedrohung „zu definieren“, im Original wieder durchaus solide „difficult to pin down“. Aus der Feststellung, Kraus „formulated a new psychological insight“ wird ein gestelztes „entwarf Kraus eine neue psychologische Erkenntnis“. Da wird „appelliert um“, Robert Musil bekommt nach dem Sprachstand des achtzehnten Jahrhunderts „kritische Verstandeskraft“ attestiert, aus dem Hinweis, dass Benn in seinen Radio-Essays „blends heroic myth with pseudo-scientific jargon“, wird die hübsche Bemerkung, dass Benn „heroisch Mythisches mit pseudowissenschaftlicher Terminologie“ vermenge.
Da steht die reizende Feststellung, dass Kraus’ letzte Jahre „überschattet waren von wechselseitigen Beschuldigungen der Sozialdemokraten“ („overshadowed by recriminations against the Social Democrats“), während er sich doch tatsächlich damit beschäftigte, Gerichtsverfahren „einzuleiten“ („initiated“), was ihm zwar vor dem Gerichtshof der Sprache, aber sicher nicht am Wiener Landesgericht für Strafsachen möglich war.
Weil das nur das Ergebnis einiger Stichproben ist, sollte man für eine vielleicht zustande kommende zweite Auflage den Text noch einmal durchgehen. Der erste Band ist übrigens mittlerweile auch als Taschenbuch vergriffen, ihn gemeinsam mit dem nun erschienenen zweiten in absehbarer Zukunft wieder aufzulegen wäre eine angemessene Wiedergutmachung für die nicht gerade glücklich gelaufene Geschichte der Eindeutschung des umfassendsten Werks über den größten Satiriker deutscher Sprache.
(Helmut Mayer, Rezension in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 24. September 2016, Rubrik: Literatur und Sachbuch, S. 14)
Dirk Glaser: In Stahlgewittern menschlicher Dummheit
Endlich ins Deutsche übersetzt: Der zweite Band von Edward Timms’ Karl-Kraus-Biographie
Anfang April 1899 erschien in Wien eine neue Zeitschrift: Die Fackel. Aufmachung und Ausstattung wirkten durchaus amateurhaft. Was niemanden der Caféhaus-Auguren verwunderte, die den gerade einmal 24 Jahre alten Herausgeber, einen böhmischen Juden namens Karl Kraus, als zwar beängstigend belesenen, aber gegen die etablierten Meinungskartelle Wiens chancenlosen Dilettanten belächelten.
Was dem verbummelten Studenten und vom Konformismus der Redaktionen frustrierten, sich deshalb ins Unabhängigkeit verheißende Abenteuer Fackel stürzenden Journalisten Kraus indes an verlegerischer Professionalität noch fehlte, machte er durch Selbstvertrauen allemal wett. Kündigte er doch nicht weniger an als die herkulische Aufgabe einer „Trockenlegung des weiten Phrasensumpfes", in den die habsburgische Fin-de-siècle-Gesellschaft zu versinken drohte.
Bei dieser Mission erfüllte Sprachkritik als Ideologiekritik einen originär politischen Auftrag. Schlechter Stil, so Kraus’ Credo, verrate unzulängliches Denken, und „Denkfaulheit" hindere an der Erkenntnis der Wirklichkeit, was wiederum gesetzmäßig zu irischem Handeln, zu realitätsblinder Politik rühre. Mit dieser Überzeugung wurzelte Kraus, der sich rühmte, gegen die für seine Generation maßgeblichen Zeitdiagnostiker, Karl Marx, Friedrich Nietzsche und Sigmund Freud, immun gewesen zu sein, tief in der Epoche der Aufklärung.
Die Schriften des Ostpreußen Immanuel Kant, die ihm das rationalistische Sozialideal des 18. Jahrhunderts, ein rechtsstaatlich organisiertes Gemeinwesen vernünftiger, selbstbestimmter Individuen, vermittelten, lieferten den Maßstab, mit dem Kraus das österreichisch-ungarische „Labor der Moderne" beurteilte, dessen Experimente für den Verehrer des Pessimisten Schopenhauer lange vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs auf die „letzten Tage der Menschheit" hinauszulaufen schienen.
Feldzüge gegen die „Hyänen" der Börse
Der David Kraus, der sich in jedem Fackel-Heft mit Goliath anlegte, dem politisch-medialen Komplex der k.u.k. Monarchie, taxierte bereits nach dem ersten Quartal anhand von exakt 236 Schmähbriefen, 83 anonymen Drohbriefen sowie einer tätlichen Attacke, was bei der weiteren Drainierung des „Phrasensumpfes" auf ihn zukommen würde. Trotzdem hielt er durch. Bis zu seinem Tod 1936, als 922 Nummern der Fackel vorlagen, seit 1912 von ihm allein, dem neben Rudolf Borchardt sprachmächtigsten deutschen Autor des 20. Jahrhunderts, in 10.000 Nachtwachen geschrieben und redigiert. Ein titanisches Werk, das, um nur einige nachmals berühmte Kraus-Adepten zu nennen, die bereits als Gymnasiasten Die Fackel lasen, Franz Kafka und Ludwig Wittgenstein, Bertolt Brecht und Kurt Tucholsky, Walter Benjamin und Gershom Scholem, Karl R. Popper und Otto Neurath lehrte, die Welt zu deuten.
Ungeachtet der immensen Wirkung zu Lebzeiten, ging das Interesse nach 1945 jedoch schnell zurück und verengte sich zudem germanistisch. Folgerichtig entstand die erste quellensatte Biographie nicht in Deutschland oder Österreich, sondern in Großbritannien, verfaßt von dem an der Universität Sussex lehrenden, dort das Zentrum für Deutsch-Jüdische Studien leitenden, heute bald 80jährigen Literaturwissenschaftler Edward Timms. 1986 kam der erste („Karl Kraus. Apocalyptic Satirist"), 1993 ins Deutsche übersetzte Band heraus, dem 2005 der zweite folgte, dessen Übersetzung noch länger auf sich warten ließ, nämlich bis zum Sommer 2016.
Von der deutschen Kritik, er liefere im ersten, 1918 endenden Band zu wenig Werkanalyse und zuviel Wiener Kultur- und Geistesgeschichte, zuviel kakanische Innen- und Außenpolitik, ließ sich Timms zum Glück nicht beeindrucken. Im Gegenteil. Vor allem die zeithistorische Konturierung ist im zweiten Band noch erheblich kräftiger ausgefallen, was unvermeidlich war, weil Kraus’ letztes Lebensdrittel abrollte im Drama der Republik Österreich, von deren Geburtswehen 1918/19 bis kurz vor ihrem Untergang per „Anschluß" im März 1938.
Allein den drei Jahren im Schatten der NS-Machtergreifüng, als sich Kraus publizistisch für das autoritäre Regime des 1934 von „ostmärkischen" Nationalsozialisten ermordeten Kanzlers Engelbert Dollfuß und dessen Nachfolger Kurt von Schuschnigg engagierte, gönnt Timms einhundert Seiten. Sie weisen die an Kraus’ Diktum „Zu Hitler fällt mir nichts ein" geknüpfte Einschätzung als unzutreffend zurück, ausgerechnet in der Stunde höchster Gefahr habe der seit 1920 gegen die „Hakenkreuzler" und das breite Spektrum rechter wie linker Republikfeinde fechtende Großkritiker resigniert.
Weitere einhundert Seiten handeln „Die Verteidigung der Republik" ab. Sie bilden zusammen mit dem ebenso ausführlichen Kapitel „Kultur und Presse" das Zentrum von Timms’ Kraus-Kosmos. Darin tritt ein einsamer Streiter für eine humane Weltordnung gegen die Mächte der Finsternis an, gegen den sich imperialistisch globalisierenden, Kriege provozierenden, Natur und Menschen vernutzenden Kapitalismus sowie gegen die Presse als seinem für den Massenbetrug unverzichtbaren Helfershelfer.
Unbestechlich leuchtet daher Die Fackel in das Dunkel der „Letzten Nacht", wo Politiker, Militärs, Banker, Börsenmakler und Medienmogule zum Totentanz der Menschheit aufspielen. Ein Pandämonium, das nicht zufällig Kafkas Horrorszenarien aus dem Innern des „stählernen Gehäuses" (Max Weber) ähnelt. Das aber sozioökonomische Realitäten, statt sie enigmatisch zu verhüllen, en détail abbildet, penibel Täter und ihre Taten protokolliert. Denn darauf, hieb- und stichfeste Beweise präsentieren zu können, beruhten die juristischen Erfolgschancen von Kraus’ Feldzügen gegen die „Hyänen" der Börse und die mit Täuschungen (Lüge und Presse sind in der Fackel nahezu Synonyma), Personaiisierungen von Politik, Privatklatsch und damals innovativer Visualisierung von Nachrichten (für funktionale Analphabeten, wie Kraus spottete) an der „Trivialisierung des Geistes" arbeitende „Gehirnwäsche-Journalistik".
Timms kommt daher nicht umhin, ein von der Kraus-Forschung eher stiefmütterlich traktiertes Thema intensiv zu erörtern: den angeblichen „jüdischen Selbsthaß", der den 1898 aus der jüdischen Gemeinde ausgetretenen Agnostiker bewogen habe, permanent Juden als Agenten des Kapitalismus anzuklagen. Stattdessen dokumentiert Timms akribisch, daß sich Kraus’ wildeste Kampagne, 1923 entfesselt gegen den betrügerischen Spekulanten Camillo Castiglioni und den Kriegsgewinnler Emmerich Békessy, den korrupten Herrn der Wiener „Revolverpresse", gegen gerichtsnotorische jüdische Wirtschaftskriminelle richtete und sich weder aus „Haß" noch aus „Vorurteilen" speiste.
Kraus reagierte mit Furor auf den Bolschewismus
Da der elitäre Bürger Kraus, der gutsituierte Sohn eines Fabrikanten, kein Marxist war – er glaubte vielmehr, es genüge, die zahllosen „Auswüchse" des Kapitalismus zu beseitigen –, reagierte er mit gleichem Furor auf den Bolschewismus. Die 1919 nach Mitteleuropa schwappende Moskauer Revolutionswelle, die in Budapest und München die von Kraus mit Gift und Galle kommentierte Etablierung jüdisch dominierter Räte-Regime begünstigt hatte, verstand er als weiteren Akt im Prozeß planetarischer Verwüstung, die für ihn ein Gemeinschaftsunternehmen von Juden und Nichtjuden, eine „jüdisch-christliche Weltzerstörung" war.
Generell stützte sich Kraus’ Kampf zwar auf den harten soziologischen Befund, der auch die zumeist jüdischen Führer der austromarxistischen Sozialdemokratie sowie seinen journalistischen Kollegen Theodor Herzl, den Urheber des Zionismus, bereits um 1900 beunruhigte: daß im Finanzwesen und in der Presse in den Zentren der Doppelmonarchie, Wien und Budapest, Juden in der Mehrheit waren. Aber, insoweit sich vom rabiaten alldeutsch-völkischen Antisemitismus schroff abgrenzend, reduzierte Kraus weder die kapitalistische Geld- noch die bolschewistische Machtgier auf das primitive Narrativ vom genetisch determinierten „Wesen der jüdischen Rasse".
Für ihn trieb das Projekt „Weltzerstörung" daher, wie dies einem zeitweiligen Wiener Mitbürger des Fackel-Herausgebers gewiß schien, nicht die „jüdische Weltverschwörung" voran, sondern ein alle ethnischen Differenzen einebnender, die Menschheit einender, universaler Defekt: die Dummheit. Ein Befund, der dem Werk des Humanisten Karl Kraus auf unabsehbare Zeit Aktualität garantiert.
(Dirk Glaser, Rezension in der Jüngën Freiheit Nr. 52/16 vom 23. Dezember 2016, S. 25)
Evelyne Polt-Heinzl: Von persönlichen Motiven angetrieben
Im Jahr 1995, neun Jahre nach dem Original, erschien in deutscher Übersetzung mit dem Titel „Satiriker der Apokalypse. Leben und Werk 1874–1918“ Band eins der umfangreichen Karl-Kraus-Biografie des emeritierten englischen Germanistikprofessors Edward Timms. 2005 folgte der zweite Band im englischen Original, er war vom Stand der berücksichtigten Sekundärliteratur her schon damals nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Elf Jahre später erscheint nun die deutsche Übersetzung, mit 689 Seiten abermals ein gewichtiges Werk, bei dem doch irritiert, dass das Gros der verwendeten Sekundärliteratur aus den 1960er- bis Mitte der 1990er-Jahre stammt und nur vereinzelt Titel vom Anfang der 2000er-Jahre auftauchen.
Problematisch ist das vor allem für die kulturhistorischen Kontexte, die einen breiten Raum des Buches einnehmen, denn gerade in Bezug auf die Zwischenkriegszeit hat sich seither einiges getan. Einzelstudien und Forschungsprojekte haben im Kontext der Moderne-Debatten für eine Fülle von Neubewertungen oder Neuentdeckungen gesorgt. Sie betreffen Oskar Strnad – den Timms auch beim Skandal um Kreneks „Jonny spielt auf“ nicht erwähnt – ebenso wie Erika Giovanna Klien und den Kinetismus oder O.R. Schatz, aber auch Joe Lederer oder Lili Grün.
Und gerade zu vielen Personen aus dem direkten Umfeld von Kraus liegen jüngere Studien vor, die einen anderen Blick eröffnen, seien es Eugenie Schwarzwald, Mechtilde Lichnowsky, Peter Altenberg, Bertha von Suttner, Adolf Loos, Camillo Castiglione oder Otto Neurath. Dessen Arbeit war im Übrigen in der Zwischenkriegszeit keineswegs „fruchtlos“, seine Bildstatistiken mit den – nicht von ihm, sondern vom im Buch nicht erwähnten Gerd Arntz entworfenen – Bildsymbolen waren in den Medien der Arbeiterbewegung allgegenwärtig.
„Durch die Erläuterung einer Fülle von kontextuellen Bezügen präsentiert das vorliegende Buch „Die Fackel“ als einen unentbehrlichen Führer durch die Kulturpolitk der Zwischenkriegszeit“, heißt es im Vorwort, und das zeigt die Gefahr der typischen Schleifen in der Kraus-Philologie. Denn eigentlich war „Die Fackel“ ein hermetischer Raum, ähnlich den Facebook-Foren unserer Tage, wie das Elias Canetti im Rückblick beschrieb: „Was nicht in eine Formel gebracht war, existierte nicht, es mußte eine Einbildung sein, es hatte keinen Bestand, sonst wäre es, sei es bei Freud, sei es bei Kraus auf irgendeine Weise vorgekommen.“
Anders als der Titel vermuten lässt, blickt Timms durchaus zurück auf die Zeit vor 1918, auf Kindheit, Werdegang und den Ersten Weltkrieg. Denn im August 1914 „war die patriotische Euphorie so groß, dass sogar Kraus für einen Moment erlag. Da er aufgrund einer Verkrümmung des Rückgrats vom Kriegsdienst befreit war, wollte er in einem ersten Impuls ein finanzielles Opfer bringen und zeichnete eine Kriegsanleihe. Doch im November 1914 widerrief er die Zeichnung“. Zu diesem Zeitpunkt machten freilich viele der im ersten Moment euphorisierten Intellektuellen, wie etwa Robert Musil, ernüchtert eine Kehrtwendung. Nur Kraus gelang es dabei, bis heute sein Einknicken von 1914 lückenlos mit dem Bild seiner moralischen Integrität in der Kriegsfrage zu überschreiben. Und gnadenlos verfolgte er fortan jene Autoren, die im Kriegspressequartier untergekommen waren – ein ‚Schutzraum‘, den er selbst eben nicht nötig hatte. Im Übrigen war er, anders als Suttner, die er als „Friedens-Bertha“ verunglimpfte, keineswegs gegen den Krieg an sich, sondern gegen „diesen“ Krieg und seine neuen Methoden. Und auch wenn man Kraus als Visionär sehen will: Dass er in seiner Satire „Reklamefahrten zur Hölle“ im Jahr 1921 „Viehwagen“ einspielt, weist nicht „auf den Holocaust voraus“, sondern auf die Usancen der Truppentransporte im Ersten Weltkrieg zurück. In diesem Zusammenhang findet sich übrigens eine der mitunter eingestreuten Verweise auf die anglo-amerikanische Gegenwart: Vor einiger Zeit bewarb eine Annonce im „Daily Telegraph“ Rundreisen zu den „Todeslagern von Treblinka“, mit „hervorragendem Reisebegleiter und gemütlichen Reisegefährten“.
Indirekt mit dem Weltkrieg verbunden ist die Tragik der österreichischen Literaturentwicklung, dass Kraus im Zuge seiner Kampfhandlungen gegen seine einstigen Verehrer der jüngeren Generation alle Ansätze einer literarischen Moderne verunglimpft hat. Freilich war die anfängliche Kriegsbegeisterung dieser Autoren zumindest vorgeblicher Grund seiner Attacken, aber wie in all seinen Feindstellungen wurde Kraus in weit größerem Ausmaß, als sein Nimbus als Moralist vermuten lässt, von persönlichen Motiven und Gekränktheiten angetrieben. So ist ein Stück „Literatur oder Mann wird doch da sehn“ von 1921 eine finale Abrechnung mit dem Expressionismus, zugleich aber eine mit Franz Werfel, dessen publizistische Vernichtung er seit einem privaten Zerwürfnis Anfang 1914 konsequent betrieb.
Auch das politische Engagement von Autoren beim Umsturz 1918 nutzte er zur Vernichtung ihrer ästhetischen Konzepte. Die Aktionen der Roten Garde mögen ein wenig aufgeregt gewirkt haben, waren aber keineswegs ohne Risiko. Egon Erwin Kisch wurde 1919 verhaftet und übersiedelte nach einer beispiellosen Pressekampagne gegen ihn im November 1921 endgültig nach Berlin. Die Desavouierung der Ereignisse rückt den Sturz eines bankrotten Systems und die damit verbundenen Hoffnungen auf eine gerechtere Gesellschaftsordnung bis heute in die Nähe einer historischen Farce.
Das umfangreichste der sechs Kapitel des vorliegenden Buches ist mit „Kultur und Presse“ übertitelt, und darin nimmt der Kampf gegen Imre Békessys Boulevardblatt „Die Stunde“ eine zentrale Rolle ein. Der Auftakt war auch hier persönlich motiviert. Hatte er zunächst nur die unkritische Bewunderung der neureichen Schieber und Spekulanten kritisiert, reagierte er mit einer scharfen Attacke, als Békessy sich auf ihn berief, worauf Kraus immer mit besonders aggressiver Distanzierung reagierte.
„Die Stunde“ setzte ein karikierend bearbeitetes Kinderbild von Kraus und seiner Schwester auf die Titelseite. Das Mittel der Fotomontage hatte Kraus seinerseits bereits 1911 verwendet und am Cover der „Fackel“ den Herausgeber der „Neuen Freien Presse“ Moriz Benedikt mit der Statue der Kriegsgöttin Pallas Athene überblendet. Doch in eigener Sache verstand er keinen Spaß und eröffnete umgehend einen Prozessreigen. Kraus mag mit seiner Plakat-Kampagne („Hinaus aus Wien mit dem Schuft“) zu Békessys Flucht aus Wien menschlich einiges beigetragen haben; der Mythos, er habe ihn als Einzelperson besiegt, unterschätzt jedenfalls massiv die ökonomischen Hintergründe für das Ende von Békessy und seinem Finanzier Castiglioni, dessen Spekulationsgeschäfte nach der Währungskonsolidierung zusammenbrachen.
1927/28 schrieb Kraus dann im Rückblick sein Stück „Die Unüberwindlichen“, gewidmet seinem Anwalt Oskar Samek, das den Justizpalastbrand vom 15. Juli 1927 mit der Causa Békessy verquickt. Gemeinsam ist den Handlungselementen, dass Kraus auf beide mit einer Plakataktion – 1927 gegen den Polizeipräsidenten Johannes Schober – reagierte. Und dass Kraus just ihn attackierte und nicht den verantwortlichen Bundeskanzler Ignaz Seipel, hatte wiederum persönliche Motive: Kraus hatte Schober 1926 um Hilfe in seinem Kampf gegen Békessy ersucht. Die eigentlich unlogische Verbindung der beiden Handlungsstränge – schließlich war Békessy bei der Polizeiaktion 1927 in Wien ein historisch erledigtes Problem – erhält aus dieser privaten Perspektive jedenfalls einen tieferen Sinn.
1923 förderte er Berthold Viertels Theaterprojekt ‚Die Truppe‘ mit einem großzügigen Darlehen, wofür sich Viertel im März 1924 mit der Inszenierung von Kraus' „Traumstück“ am Lustspielhaus Berlin revanchierte. Auch wenn das unkommentiert bleibt, kann man die Glosse beinahe hören, die Kraus in die Feder gelaufen wäre, hätte er Ähnliches von Albert Ehrenstein oder Felix Salten erfahren. Auch unlautere Mittel waren Kraus keineswegs fremd. „Manchmal hat es den Anschein“, so Timms, als ob er etwa Heinrich Heine „um jeden Preis in Misskredit bringen wollte, etwa wenn er fehlerhaft zitiert oder Stereotype bringt, die er doch eigentlich verachtet hat“, genauso wie er „seine Beweisführung“ oft „durch Pauschalurteile“ untergräbt.
Eine besondere Problemzone ist Kraus' Haltung zum Ende der „parlamentarischen Demokratie“ in Österreich, die 1933 freilich nicht „gescheitert“, sondern von Dollfuß bewusst ausgeschaltet worden ist. Dass Kraus seinen Anwalt selbst 1936 noch gegen einen Sketch im Kabarett Stachelbeere gerichtlich einschreiten ließ, zeigt vielleicht am deutlichsten seine unheilbare Egomanie und bringt die These von seiner „Wandlung zum Demokraten“ in der Ersten Republik doch ins Wanken.
Manches Irritierende im vorliegenden Buch mag der – trotzdem bewundernswerten – Übersetzung geschuldet sein. Was ist gemeint, wenn es heißt, Kraus „verurteilt die Bürgerschicht eher für die soziale Ungerechtigkeit als für wirtschaftliche Ausbeutung“? Anderes hat prinzipiellere Ursachen. Dass es „keinen Hinweis“ gäbe, dass Irma Karczewska, die Kraus 1905 als 15-Jährige zur Geliebten nahm, „sich selbst als Opfer von sexuellem Missbrauch gesehen hätte“, klingt so vertraut euphemistisch wie die Usance, Kraus' manifeste Misogynie als „antifeministisch“ zu bezeichnen. Und etwas übergriffig wirkt es auch, wenn es über den – zweifellos problematischen – Fritz Wittels heißt, er „war sieben Jahre jünger als Kraus, doch was ihm an Lebensjahren fehlte, macht er durch Unverschämtheit wett“.
Kraus' „Darstellung gottloser Juden als Verfechter von ‚Fortschritt‘ und ‚Modernität‘ kommt der Haltung katholischer Reaktionäre sehr nahe“, heißt es an einer Stelle. Doch so deutlich werden die problematischen Aspekte der Person Karl Kraus im vorliegenden Buch selten formuliert, häufiger muss man die Schlüsse lesend selber ziehen.
(Evelyne Polt-Heinzl, Rezension in der Furche #9/17 vom 2. März 2017)
https://www.furche.at/feuilleton/von-persoenlichen-motiven-angetrieben-1175413
Stefan Tuczek: Die Fackel im Ohr
Nach langer Wartezeit liegt die deutsche Übersetzung des zweiten Bandes von Edward Timms Karl-Kraus-Biografie vor
1986 erschien mit Karl Kraus. Apocalyptic Satirist, Culture and Catastrophe in Habsburg Vienna in der Yale University Press der erste Band von Edward Timms auf zwei Bänden angelegter Biografie über Karl Kraus. Der Germanist Timms hat sich nicht weniger zur Aufgabe gemacht, als Kraus wieder bekannt zu machen: Ende der 1980iger Jahre war der Schriftsteller, Herausgeber, Satiriker, Politik-, Kultur-, Ideologie- und Sprachkritiker Karl Kraus nicht nur im englischen, sondern auch im deutschsprachigen Sprachraum fast vergessen. Zwar wurde Kraus als gewitzter Satiriker geachtet, dessen Aphorismen immerhin als kleine Sammelbändchen erschienen, primär aber war er als großer Nörgler bekannt, der allenfalls von Germanisten in Fußnoten bedacht wurde. Die große Kraus-Renaissance brachte ohne Frage Timms monumentale Biografie, deren erster Teil auf Deutsch erst 1995 unter dem Titel Karl Kraus. Satiriker der Apokalypse. Leben und Werk 1874 bis 1918 im Franz Deuticke Verlag und später als Taschenbuch bei Suhrkamp erschien.
Timms erzählt nicht nur über Kraus, wie es in einer einfachen Biografie üblich wäre. Er beschreibt auch die mannigfaltige Literatur- und Kulturszene Wiens, deren fester Bestandteil Kraus war. So kommen etwa auch Sigmund Freud und Hermann Bahr mit seinem Wiener Café-Haus-Literatenzirkel vor. Und dies muss man verstehen: Zwar wird Kraus immer wieder als Nörgler und Besserwisser dargestellt, und die Geschichten, dass er von wütenden Gegnern, die er in seiner Zeitschrift Die Fackel satirisch-polemisch angegriffen hatte, mit Ohrfeigen und wüsten Beschimpfungen bedacht wurde, mögen nicht unbegründet sein. Den Nimbus des ewigen Kritikers und scharfen Gegners der Wiener Moderne jedoch konnte sich Kraus nur erarbeiten, indem er auch ein großer Kenner und Intellektueller seiner Zeit war. Kraus hat sehr früh begriffen, dass, wer seine Kritik und Satire mit Substanz füllen will, sein kritisiertes Objekt genau kennen muss. Und so ist auch Timms Kraus-Biografie gleichzeitig eine Kulturgeschichte Wiens.
Dass seine Biografie weit mehr als nur ein Buch füllen wird, wusste Timms schon früh. Dass der Leser aber so lange darauf warten werden muss, endlich in den Genuss der Erzählung der letzten Lebensjahre von Kraus zu kommen, war nicht zu erwarten. Im Jahre 2005 erschien der zweite Band unter dem Titel Karl Kraus. The Post-War Crisis and the Rise of the Swastika – nach knapp zwanzig Jahren. Nochmals zehn (!) Jahre musste der deutsche Leser auf eine Übesetzung warten. Der Mammutaufgabe des Übersetzens stellte sich Brigitte Stocker, so dass das Buch unter dem Titel Karl Kraus. Die Krise der Nachkriegszeit und der Aufstieg des Hakenkreuzes im Verlag Bibliothek der Moderne [sic] erscheinen konnte. Sowohl der Übersetzerin als auch dem Verlag ist großer Dank geschuldet, dass sie dieses nunmehr abgeschlossen Lebenswerk von Timms den deutschen Lesern zugänglich gemacht haben.
Endet der erste Band mit dem Jahr 1918, beginnt der zweite Band dort auch wieder, nimmt die Fäden der Kraus’schen Biografie sowie der Beschreibung der wienerischen Kulturgeschichte wieder auf und endet mit dem Tod von Kraus. Es ist bezeichnend, dass zeitgleich mit dem Ende von Karl Kraus auch die moderne Kultur und Literatur in Österreich durch den Einmarsch der Nationalsozialisten ihr Ende fand.
Der zweite Band der Biografie ist genauso vielschichtig und nicht nur auf Kraus ausgelegt wie der erste Band. Timms versteht es hervorragend, Kraus und seine literarischen Werke, besonders die Dritte Walpurgisnacht steht im Mittelpunkt der Betrachtungen, zu beschreiben, auszulegen und in ihren historischen Kontext einzubetten. Timms beweist, dass Kraus den Aufstieg der Nationalsozialisten nicht stumm hingenommen hat, sondern sich wortgewaltig dazu äußerte, in dem ihn eigenen polemisch-satirischen Ton. Den Leser erwartet keine trockene Biografie, vielmehr legt Timms dem Leser die ganze Wiener Moderne vor, nichts wirkt überflüssig und nie hat man das Gefühl, dass Timms etwas vergessen hätte – hier merkt man Timms Liebe für das Detail und vor allem für die Vita von Kraus. Mit großem Respekt nähert er sich Kraus und stellt ihn als das dar, was er wirklich war: Nicht (nur) als Nörgler, sondern als Zeitkritiker und Intellektuellen eines Ranges, den es heute so nicht mehr gibt.
Schade ist nur, dass der erste Band mittlerweile nur noch antiquarisch erhältlich ist. Denn um diesen zweiten Teil vollständig verstehen und genießen zu können, bedarf es doch des ersten Teils. Es bleibt zu hoffen, dass sich ein Verlag erbarmt, auch diesen wieder aufzulegen, damit der zweite Band dieser gewichtigen Kraus-Biografie nicht für sich allein zu stehen braucht. Denn dies kann Timms: Lebendig, kenntnisreich und mit viel Herzblut erzählen. Sein großes Verdienst ist, dass er Kraus aus den Fußnoten der Geschichte herausholt und ihn für den interessierten Leser wieder lebendig macht. Verdient hat Karl Kraus es allemal.
(Stefan Tuczek, Rezension für literaturkritik.de Ausg. 10-2017, veröffentlicht am 19. September 2017)
https://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=23687
Gregor Auenhammer: [Rezension]
[…] Unerwartete Erkenntnisse über eine prägende Figur des österreichischen Kulturlebens birgt Edward Timms kommentierte Schriftensammlung von Karl Kraus: Die Krise der Nachkriegszeit und der Aufstieg des Hakenkreuzes. Kraus’ Zeitschrift Die Fackel dient dabei als unentbehrlicher Führer durch die Kulturpolitik dieser Zeit. Seine größten Polemiken werden als „Verteidigung der Republik“ analysiert. Zentral seine zwiespältige Allianz mit den Sozialdemokraten sowie seine Konfrontationen mit dem konservativen Kanzler Seipel. Die Legende, Kraus wäre Hitler schweigend begegnet, wird definitiv widerlegt. Schon früh hatte er vor dem Aufstieg der Nazis gewarnt. […]
(Gregor Auenhammer, Rezension im Standard-Album vom 27. Jänner 2018, A7)
https://www.derstandard.at/story/2000073066765/sachbuecher-zum-gedenkjahr-2018-im-ozean-der-zeit