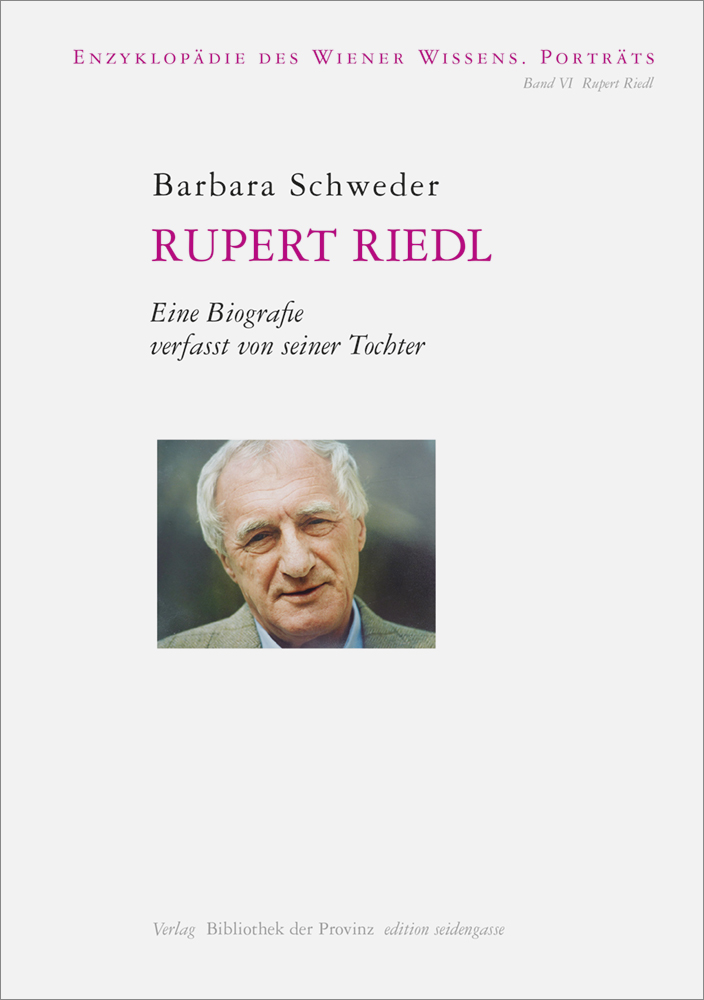
Rupert Riedl
Eine Biografie verfasst von seiner Tochter
Barbara Schweder, Rupert Riedl
edition seidengasse: Enzyklopädie des Wiener Wissens: PortraitsISBN: 978-3-99028-614-2
21 x 15 cm, 200 Seiten, Hardcover
€ 23,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
Rupert Riedl war ein Leben lang Morphologe. In seinen Augen war es kein Zufall, dass die Morphologie sich gerade in der Biologie etabliert hat, wo kontroversielle Methoden aufeinanderstoßen. Heute noch klafft ein methodischer Riss zwischen den Natur- und Geisteswissenschaften: die Spaltung des Weltbildes.
Als vergleichender Morphologe beforschte Rupert Riedl die Entwicklung des Geistes. Er erkennt Denkmuster als Anpassungsprodukt an Naturmuster, da von allen möglichen Interpretationen der Natur jene am effektivsten sein müssen, die dieser am meisten entsprechen. Wir werden bereits mit stammesgeschichtlich erprobten Erwartungshaltungen geboren und unser ratiomorpher Apparat operiert mit vier vernunftsähnlichen Hypothesen. Die Umwelt des modernen Menschen ist jedoch derart komplex, dass unsere angeborenen Erkenntnismechanismen längst nicht mehr ausreichen, um das Netz hausgemachter Zugzwänge zu durchschauen. Rupert Riedl ruft dazu auf, die eigenen Anschauungsformen zu übersteigen.
Es ist die vornehmste Aufgabe der Wissenschaft, die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu lindern. (Rupert Riedl)
Als Tochter des Rupert Riedl habe ich den wissenschaftlichen Weg meines Vaters lange Zeit begleitet. Vater las in einem Fünf-Jahre-Zyklus zu den Themen seiner Bücher „Biologie der Erkenntnis“, „Spaltung des Weltbildes“, „Begriff und Welt“ und „Wahrheit und Wahrscheinlichkeit“ und leitete unter anderem die bekannte Seminarreihe „Theorie der Naturwissenschaften“ (vulgo Öser-Riedl-Sexl-Seminar) sowie den Altenberger Kreis im Hause Lorenz, wo er später das Konrad-Lorenz-Institut für Evolutions- und Kognitionsforschung gründete. In Wien gründete er kurz vor seinem Tod den Club of Vienna in Anlehnung an den Club of Rome.
Vater war Morphologe und blieb das ein Leben lang. In seinen Augen war es kein Zufall, dass die Morphologie sich gerade in der Biologie etabliert hat, wo kontroversielle Methoden aufeinanderstoßen. Heute noch klafft ein methodischer Riss zwischen den Natur- und Geisteswissenschaften. Vater sprach von der Spaltung des Weltbildes.
Als vergleichender Morphologe wandte sich Vater in den frühen 1970er Jahren der Entwicklung unseres Geistes zu. Denkmuster, erkannte er, müssen ein Anpassungsprodukt an die Naturmuster sein, da von allen Möglichkeiten, die Natur zu interpretieren, jene am vorteilhaftesten sein müssen, die dieser Natur am meisten entsprechen. Wir werden bereits mit stammesgeschichtlich erprobten, vernunftsähnlichen Erwartungshaltungen geboren.
Vater entwickelte aus dem Ursachenkonzept des griechischen Philosophen Aristoteles (causae) vier Hypothesen, mit denen unser ratiomorpher (vernunftsähnlicher) Apparat operiert. Die Hypothese vom anscheinend Wahren lässt uns glauben, dass mit jeder Bestätigung einer Prognose die Bestätigung der nächsten Prognose wahrscheinlicher werde. Die Hypothese vom Ver-Gleichbaren enthält die Erwartung, dass das Ungleiche ausgeglichen werden dürfe, dass Ähnliches die Voraussicht weiterer Ähnlichkeiten zuließe. Die Hypothesen von den Ur-Sachen und vom Zweckvollen gehören untrennbar zusammen, obwohl sich die Naturwissenschaften der Ursachen, die Geisteswissenschaften der Zwecke angenommen haben, als gäbe es keine Verbindung. Kausalzusammenhänge und Absichten zu erwarten, ist uns derart selbstverständlich, dass es der Vernunft selbst kaum gelingt, einmal wahrgenommene Zusammenhänge zu widerlegen.
Die Umwelt des modernen Menschen ist derart komplex, dass unsere angeborenen Möglichkeiten der Erkenntnis längst nicht mehr ausreichen. Vater ruft dazu auf, die eigenen Anschauungsformen zu übersteigen. Nur so kann ein Überleben der Menschheit auf diesem Planeten gelingen.
[Enzyklopädisches Stichwort]
[edition seidengasse | Enzyklopädie des Wiener Wissens · Porträts, Bd. VI.
Begründet 2003 u. hrsg. von Hubert Christian Ehalt für die Wiener Vorlesungen, Dialogforum der Stadt Wien.]
