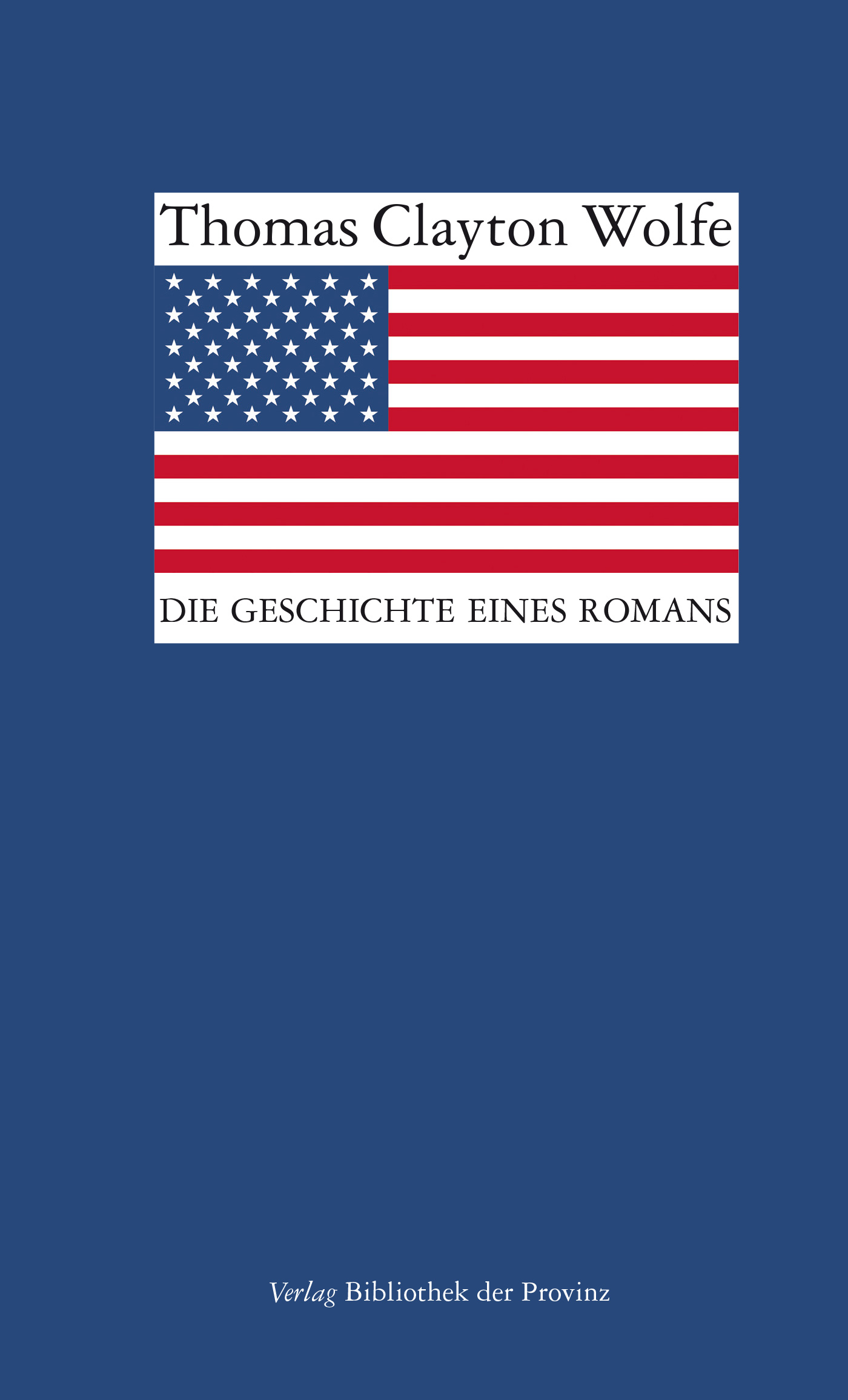
Die Geschichte eines Romans
Essay
Thomas Clayton Wolfe
ISBN: 978-3-99028-743-9
19 x 12 cm, 80 Seiten, Hardcover
15,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
[The Story of a Novel, übersetzt von Hans Schiebelhuth.]
Ich kann keinem Menschen sagen, wie man Bücher schreibt; ich kann auch nicht versuchen, Regeln aufzustellen, nach denen jemand instand gesetzt sein würde, seine Bücher bei Verlagen, seine Geschichten bei gut zahlenden Zeitschriften unterzubringen. Ich bin kein Erwerbsschriftsteller, ich bin nicht einmal gelernter Schriftsteller, ich bin einfach ein Schriftsteller, der im Begriff steht, sein Handwerk zu lernen, der gerade dabei ist, auf den Gebieten der Linienführung und Baufügung und der sprachlichen Verdeutlichung jene Entdeckungen zu machen, die er notwendig machen muss, um die Arbeit leisten zu können, die er leisten will.
Rezensionen
Hans Durrer: [Rezension zu: Thomas Clayton Wolfe, „Die Geschichte eines Romans“]Als dieser Titel in der Verlagsvorschau meine Aufmerksamkeit fand, war mir nicht bewusst, dass es sich beim Autor um den berühmten Thomas Wolfe von „Schau heimwärts. Engel“ und von „Zeit und Strom“ (der in meiner noch ungelesenen Version „Von Zeit und Fluss“ heisst) handelt. Auch war mir nicht bekannt, dass er nicht einmal 38 Jahre alt wurde – mich verwundert nicht nur, dass jemand in so jungen Jahren imstande ist, solche Wälzer wie „Von Zeit und Fluss“ zu schreiben, es ist mir schlicht ein Rätsel, wo solche Schaffenskraft herkommt.
So recht eigentlich, weiss er selber nicht, wie es zu seinem ersten Buch (und davon handelt dieser schmale Band) gekommen ist. „Ich bin selber nie recht dahintergekommen, vermute aber, dass die unbestimmte Kraft in mir, die schon lange zum Schreiben drängte, und die sich ihren Weg bahnen wollte, mich dazu antrieb.“
Thomas Clayton Wolfe lässt sich in „Die Geschichte eines Romans" unter anderem darüber aus, dass, wenn man einen Roman veröffentlicht hat, sich irgendwie schämt, weil man so recht eigentlich alles hätte anders und besser machen sollen. Auch will man möglichst nichts mehr davon wissen und doch gleichzeitig berühmt und verehrt werden. Dazu kommt die Frage: Was jetzt?
Für Wolfe gibt es keine Zweifel, dass jede künstlerische Tätigkeit autobiographisch ist, ja, notwendigerweise sein muss. „Trotzdem ist für einen schöpferischen Menschen die buchstäbliche Umsetzung seiner eigenen Erfahrung unmöglich“, behauptet er und fügt hinzu: „Alles in einem Kunstwerk wird verwandelt und umgesetzt durch die Persönlichkeit des Künstlers selbst. Und was mein erstes Buch angeht, so ist, ehrlich gesagt, nicht eine einzige Stelle darin, die tatsachengetreu wäre.“
Autobiographisch bedeutet für Wolfe offenbar tatsachengetreu, als so, wie es sich in Wirklichkeit (und für andere nachvollziehbar) zugetragen hat. Eine zwar gängige, doch für mein Dafürhalten sehr beschränkte Auslegung für das „Sein Leben Selber Zeichnen“ (was Autobiographie wörtlich bedeutet), denn schliesslich sind auch des Autors Fantasie, seine Träume und Vorstellungen wirklich, mithin alles was er denkt (oder es in ihm denkt), tut und auch nicht tut.
„Die Geschichte eines Romans“ ist vor allem eine Geschichte über das Schreiben, genauer: über das Leben, den Alltag, des Schreibenden. „Es gibt kein künstlerisches Vakuum; es gibt keinen Zeitpunkt, in dem der Künstler in einer idealen Atmosphäre arbeiten könnte, frei von Kampf, wie ihn alle Menschen durchzumachen haben.“
Auch Gefühle des Verzweifelns, des totalen Versagens begleiten sein Scheiben. Ob er wirklich der Handelnde ist, weiss er nicht mit Sicherheit zu sagen – ihm scheint, als ob etwas Besitz von ihm genommen, sein Buch sich selbst geschrieben habe.
Eigenartiges geschieht, als das Buch veröffentlicht ist. Er erhält anonyme Briefe der gemeinsten Art, wird Opfer giftiger Angriffe, der Pfarrer predigt von der Kanzel dagegen. Er erfährt das, was alle, die schreiben, erleben – die Leute lesen in einen Text rein, was sie wollen
Der dünne Band, übersetzt von Hans Schiebelhuth, bearbeitet und lektoriert von Paul Ëñǧł, herausgegeben von Richard Pils, präsentiert sich ansprechend (schöner, fester Einband, lesefreundlicher Satzspiegel), die Umschlaggestaltung trifft mit der Verwendung der nordamerikanischen Flagge, worum es dem Autor wesentlich zu tun ist – und mich stört: das Suchen seines Amerika, das Heraufbeschwören „der einmaligen und einzigartigen Substanz dieses Landes“. Lieber wäre mir, all diese Einzigartigkeiten (die amerikanische, die chinesische, die japanische etc.) nicht dauernd zu betonen und herauszustreichen. Trotzdem: Wer selber schreibt, liest dieses Buch mit Gewinn.
(Hans Durrer, Rezension für Buchkritik.at vom 24. Juni 2018)
