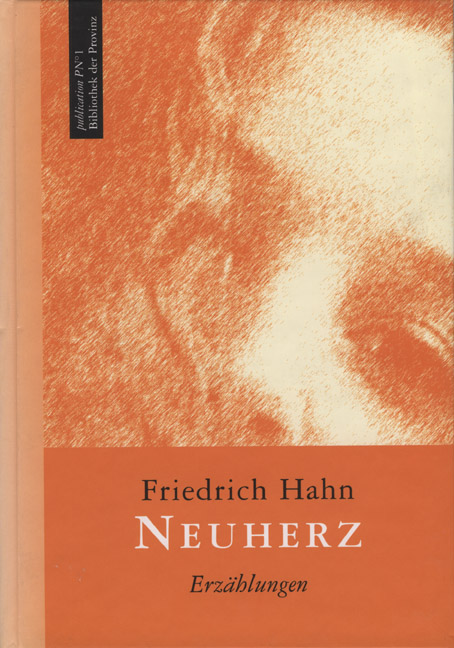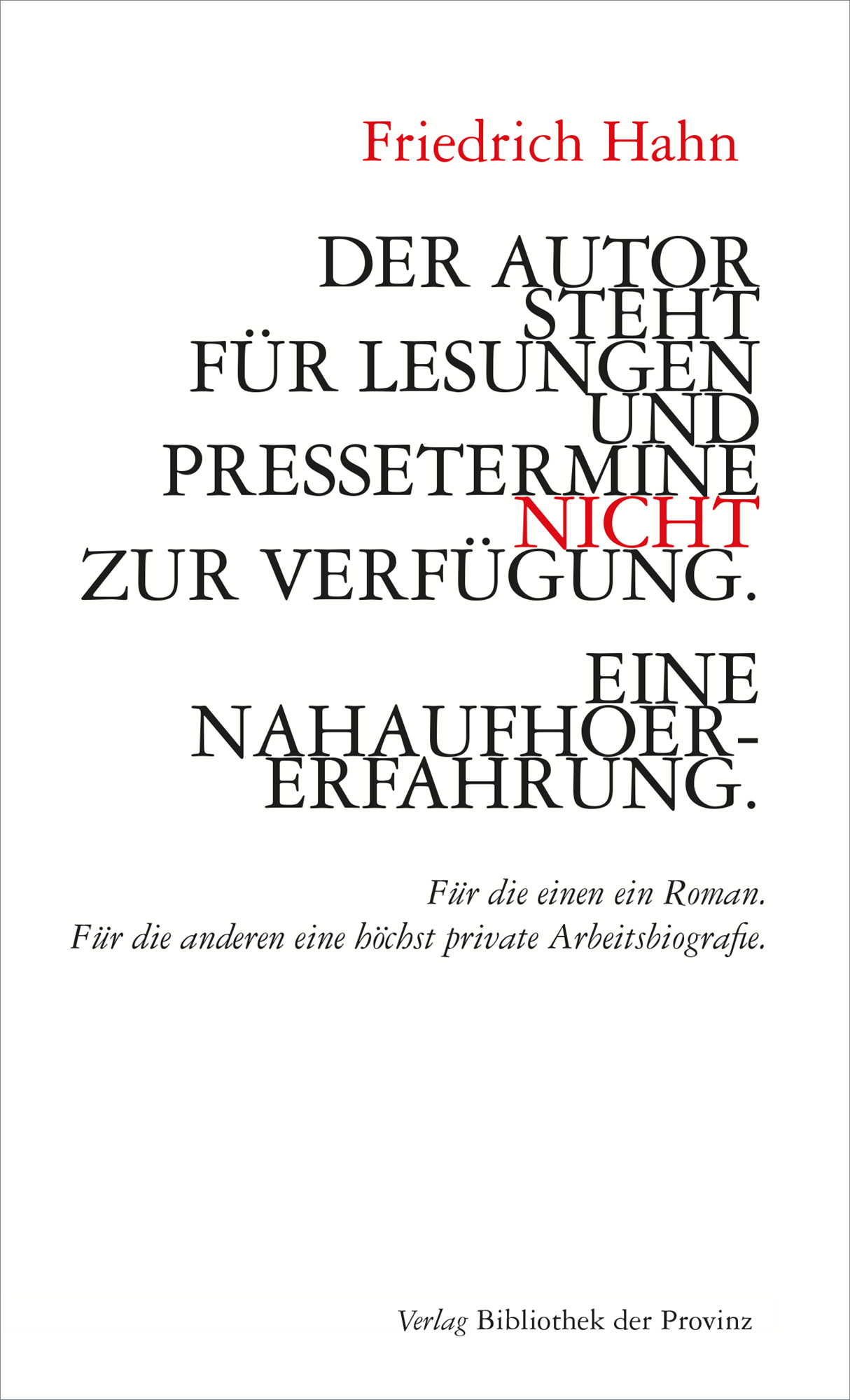
Der Autor steht für Lesungen und Pressetermine NICHT zur Verfügung. Eine Nahaufhörerfahrung.
Für die einen ein Roman. Für die anderen eine höchst private Arbeitsbiografie.
Friedrich Hahn
ISBN: 978-3-99028-826-9
19×11,5 cm, 320 Seiten, Klappenbroschur
24,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
„Ich bin mit meinem Text am Ende. Der Satz klingt nach schlussendeaus. Nun. Da steht er. Ein Satz wie er lapidarer nicht sein könnte. Ich lese ihn immer und immer wieder. Und dabei mach ich mein Schriftstellergesicht. An dem muss ich auch noch arbeiten. Aber wie macht man ein Exschriftstellergesicht?“
In 40 Jahren hat Hahn nun 40 Bücher und an die 20 Arbeiten für Hörfunk und Bühne veröffentlicht. Im November 2017 dann der Beinbruch. Zeit der Reflexion. Hahn hält inne, zieht Bilanz. Es ist eine Zeit der kalendarischen Vermerke, handwerklichen Überlegungen und poetischen Entwürfe. Und er kommt zu einem Entschluss: Er will sich vom Literaturbetrieb zurückziehen. Und das Schreiben? Nein, das Schreiben kann und will er nicht aufgeben. Aber gibt es ein Schriftstellerleben ohne Literaturbetrieb? Täuscht er uns? Täuscht er sich selbst?
Hahn gelingt ein beeindruckendes, weil authentisches Lebens- und Berufsbild von einem, der sich der Literatur verschrieben hat. Was passiert, wenn sich die Literatur in das Leben drängt? Oder umgekehrt: das Leben in das Schreiben? Was ist, was wäre das Gemeinsame? Leben und Literatur suchen das Miteinander in Gegensätzen: Demut – Unmut. Größenwahn – Minderwertigkeitskomplex. Nähe – Ferne. Als eines seiner Vorbilder nennt Friedrich Hahn Bazon Brock, den Künstler ohne Werk, den Generalist mit dem speziellen Drall ins Nebenhinaus. Da, wo es noch das Staunen gibt.
Rezensionen
Helmuth Schönauer: [Rezension]Eine Autobiographie hat in erster Linie den Zweck, für die Auto-Person eine gültige Lebenserzählung auszudrücken. Die Leserschaft weiß um diese Subjektivität und kann sich daher hemmungslos auf die erzählte Geschichte stürzen ohne lange zu überlegen, wie wahr und ausgeräumt der erzählte Lebenslauf ist.
Friedrich Hahn packt das Genre Autobiographie mit beiden Schreibhänden bei den Hörnern, erzählt seine Geschichte und steigt dann in eine Meta-Ebene, um das Dargestellte quasi vom Jenseits aus noch einmal zu relativieren. Der Ausdruck „Nahaufhörerfahrung“ lehnt sich literarisch an den medizinischen Begriff „Nahtoderfahrung“ an, in beiden Fällen geht es um den Super-Gap, mit dem man den Tod erzählen kann.
Die Autobiographie thematisiert den Ausstieg aus dem Literaturbetrieb, indem sie zeigt, wie ein hundsnormales Individuum in die Mühlen der Literatur und in Lebensgefahr geraten kann. Denn Schreiben ist nicht nur eine Erfüllung oder ein Lebenssinn, es kann auch wie eine Sucht stracks in den Untergang führen.
Im wesentlichen sind drei Hauptstränge zusammengeflochten, die manchmal auf einander verweisen und sich dann wieder aus dem Weg gehen. Dabei entstehen drei „Werke“, das Arbeitswerk, das Familienwerk und das Literaturwerk. Der Autor merkt erst beim Schreiben, wie stark diese drei Werke zusammenhängen. Auch für ihn gilt: Je ehrlicher er zu sich selbst ist, umso mehr erfährt er über sich selbst.
In der Arbeitswelt gibt es zu Beginn der Karriere fixe unkündbare Jobs im Bankwesen, später als Startupler, wie man damals noch nicht gesagt hat, stehen vor allem wirtschaftliche Zufälligkeiten und ein abschüttelnder Markt im Weg. Die Werbe-Branche ist immer unberechenbar, aber immerhin ermöglicht sie es, Elemente der Literatur aufzugreifen und scheinbar als Kunsthandwerk einzubringen.
Das Familienleben beginnt mit dem damals üblichen Häuslbauer-Schock, kaum zwanzig, scheint auch schon alles vorbei zu sein, Haus, Frau, Fehlgeburt, die Scheidung bringt erstmals kurzfristig Entlastung. Es folgen noch eine Künstlerbeziehung und eine On-Off-Geschichte, die zu einer Tochter führt.
Das literarische Leben hat in etwa drei Schübe. In den Siebziger Jahren reüssiert der Autor mit der eigenen Jugend und dem unverkäuflichen Buch „kältefalle“ (1979), das wahrscheinlich keinen einzigen Leser gesehen hat. Als Verlagsnomade erwirbt er sich mit diversen Gedichtbänden eine dahinschleichende Präsenz, ehe er mit den Romanen zum eigentlichen Schreiben und zumindest für sich selbst zum Durchbruch findet. Wo ein Durchbruch, da auch ein Zusammenbruch, heißt es in der Psychoanalyse lapidar. Der Autor beschließt, aus dem Literaturbetrieb auszusteigen.
Die Welten werden nicht nur thematisch sondern auch zeitlich miteinander verwoben. Der 65-Jährige schreibt über seine Literaturwelt als 50-Jähriger, in der die Arbeitswelt als 25-Jähriger eingebaut ist.
Der Schreibeinsatz gilt immer sich selbst und ist als Autochthonie angelegt. Leserschaft und Rezeption sind von vorneherein nicht geplant. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass die Berufe Banker und Werbefritze es nie auf ein Gegenüber angelegt haben, sondern immer ihre Produkte in den Markt dreschen. So wird auch Literatur zwischendurch blindlings auf den Markt geworfen. Eine Bemerkung einer Verlegerin, wonach man in ihrem Fall ein paar Spielregeln der Textur eingeführt habe, führt zu Verstimmung und Trennung.
Im Bibliothekswesen gibt es für diesen Zustand eine einfache Erklärung: Es gibt Bücher für die Leser und Bücher für die Autoren!
So schimmern in der Auto-Analyse immer recht ernüchternde Verkaufszahlen durch, die Literaturhäuser verkaufen den eigenen Blabla und haben kein Interesse an der Literatur anderer Autoren. Rezensionen muss man sich zusammenbetteln, alles wird zu einer ziemlich frustrierende Angelegenheit, wahrscheinlich, weil die Literatur letztlich doch das Leben widerspiegelt. In diesem Kontext wirkt die Bibliographie mit über dreißig Werken als ein Stoßgebet, das man herunter hechelt, ohne den Inhalt zu begreifen.
Auch hier gibt es eine beruhigende Botschaft aus der Bibliotheksszene: Für einen Leser, den wir bei der Veranstaltung sehen, kommen zehn stumme, die zu Hause lesen. Für einen Autor, den wir in der Zeitung lesen, kommen zehn stumme, die das Schreiben aufgegeben haben.
Gerade als die Autobiographie zum 65sten abgeschlossen ist, gibt es noch ein Überraschungskapitel, das sich Nahaufhörerfahrung nennt. Das erzählende Ich ist aus der literarisch aufgemotzten Welt ausgestiegen und in einer Meta-Welt, wo der Sinn neu entworfen wird. Der Markt ist Wurst, die Romane entstehen aus einem Drall in die Zukunft, zumal alle anderen Zeitvertreibungen belanglos sind. Der Mobilitätsradius ist eingeschränkt, weil ein Bein nicht mehr richtig will, die Freunde sterben aus den Freundschaftskohorten heraus, die Familie ist eine Generation weiter gerückt, die Eltern sind verstorben, die Tochter ist erwachsen. Die Abrechnung ist vollzogen, es geht sich vielleicht auf null aus. „Literatur als sei nichts gewesen. Leben als sei nichts gewesen.“ (315)
Allein wenn alle, die zu Lebzeiten aus dem Literaturbetrieb ausgestiegen sind, diese friedliche Zusammenfassung der Literatur lesen, kriegt Friedrich Hahn für seine Begriffe einen Bestseller zusammen. Und noch eine dritte Weisheit aus dem Bibliothekswesen: Ein Autor wird nie für das bekannt, für das er bekannt sein wollte.
(Helmuth Schönauer, GEGENWARTSLITERATUR 2837)
Peter Pisa: Schreiben ja, aber Schriftsteller will Friedrich Hahn keiner mehr sein
Warum, steht in dem Buch mit dem Titel „Der Autor steht für Lesungen und Pressetermine NICHT zur Verfügung".
Von seinem Roman „Von Leben zu Leben“ wurden 84 Exemplare verkauft. Trotz guter Kritiken. Im KURIER z.B. stand: Hahn sei einer der originellsten Schriftsteller Österreichs. „Das merkt man allein schon, wenn er den Michael präsentiert, indem er – Zitat – bloß über ihn sagt: Er habe nur ein Testbild vom Leben im Kopf und kein Programm.“
Der Beweis
84 Exemplare. Friedrich Hahn (…) ist gereizt. Er bemüht sich um Humor. Und will nicht mehr Schriftsteller sein. Schreiben schon. Aber nicht mehr Manuskripte an Verlage schicken, auf Rezensionen hoffen, Lesungen halten. Sein – letztes? – Buch ist Autobiografie; bissl eitel, bissl traurig, aber der Beweis:
Was der Norweger Knausgård kann, das kann auch Hahn. Interessiert es wirklich, dass er Kehlmann nicht mag? Dass Hahn Sudokus braucht? Aber ja, es interessiert! So weit, Sonett (= Hahn).
(Peter Pisa, Rezension im Kurier vom 24. August 2019)
Walter Klier: [Rezension]
Vor Kurzem habe ich einen Klassenkameraden aus der Volksschule neu kennengelernt. Einzig an seinen Vornamen konnte ich mich vage erinnern, doch im Gespräch tauchten sofort der damalige Lehrer und andere Schüler aus der Klasse auf und auch die besonderen Umstände – wir besuchten etwas, das „Übungsschule“ hieß und im selben Gebäude wie die „Lehrer und Lehrerinnenbildungsanstalt“ untergebracht war. Die Auszubildenden hießen „Kandidaten“ und übten an uns, wie es sein würde, Volksschullehrer zu sein.
Ähnlich ging es mir mit einem jüngst erschienenen autobiografischen Buch (Friedrich Hahn: Der Autor steht für Lesungen und Pressetermine nicht zur Verfügung. Eine Nahaufhörerfahrung. Bibliothek der Provinz, Weitra, o.J., 318 S.), in dem es um eine österreichische Schriftstellerkarriere geht. Ich kannte so ziemlich alle und alles, was darin vorkam, nur der Ich-Erzähler trat praktisch neu in mein Leben. Parallel zu Gerhard Henschels „Erfolgsroman“ ist dies ein absoluter Misserfolgsroman. Das hat auch was, ein patschertes Schriftstellerleben bis ins kleinste Detail nacherzählt zu bekommen. Zumindest Insider des Betriebs dürften ihr Vergnügen daran haben. Die Übrigen müssen das Wagnis einfach eingehen. […]
(Walter Klier, Rezension in der Wiener Zeitung vom 9. November 2019, S. 39)
https://www.tagblatt-wienerzeitung.at/meinung/blogs/litblog/2037005-Lauter-Ich-Erzaehler.html
Gabriele Kögl: [Rezension]
Es ist Ende August 2017. Friedrich Hahn hat zu diesem Zeitpunkt 32 Bücher geschrieben und über 20 Texte und Performances für Hörfunk und Bühne gestaltet. Und trotzdem hat er das Gefühl, dass niemand auf seinen neuen Roman neugierig ist, den er gerade abgeschlossen hat.
Zur Literatur kam er über die Lyrik, mit der er experimentierte, indem er romantisches Gestammel zertrümmerte. Er entdeckte Heimrad Bäckers „neue texte“ und sah, dass es für seine Spielwiese einen Name gab: Konkrete Poesie. Noch vor der Matura erschienen seine „spiegelbilder“ in den „neuen texten“.
Hahn überlegt, seinen Vorlass der Nationalbibliothek anzubieten, und arbeitet seine literarische Vergangenheit auf. Das ist der Ausgangspunkt für die vielen Erinnerungen und Überlegungen in diesem Buch. Und es ist spannend und vergnüglich, Friedrich Hahn dabei zu begleiten. Mit viel Selbstironie, aber auch mit einiger Gekränktheit beschreibt er das Leben mit der schweigsamen Mutter, die ihre Gefühle immer zurückgehalten hat, und dem trunksüchtigen Vater in einer Zimmer-Küche-Kabinettwohnung bis hin zum Besuch des Gymnasiums in der Kundmanngasse, eine Schulbildung, die für ein Eisenbahnerkind nicht vorgesehen, aber durch die Politik Kreiskys möglich geworden war. Seine überbordende Phantasie bringt ihn bald zur Werbung, und Hahn erkennt, wie nahe Werbung und Lyrik beieinander liegen. Er wird Werbedesigner, kreiert Logos für Banken und Versicherungen genauso wie für Verlage, Literaturvereine und Buchhandlungen und versucht ein Leben lang den Spagat zwischen Werbung und Literatur. Hahn erfand die „Wandspielwochen“ mit jeweils 15 bis 20 Plakatstellen über ganz Wien verstreut. Auf türkisem Hintergrund prangte in Grellrot der Sager: „der kunst unter den rock geschaut!“
Er versucht sich auch als Verleger, organisiert die „Dichte®meile“ im 9. Bezirk, ruft als grüner Bezirksrat das Bezirksschreiberstipendium ins Leben und hält Literaturkurse. In einer Schule wird er einmal sogar mit „Guten Tag, Herr Literatur!“ begrüßt.
„Allerhand Hahn“, wie er bezeichnet wird, ist zu kurz gegriffen für den Tausendsassa, der sofort hundert Ideen hat, wenn er ein Medium zu fassen bekommt. Aber er leidet unter dem Schicksal eines verkannten Generalisten. Er fühlt sich nirgendwo wirklich dazugehörig und sieht sich meist „mittendrin unter Außenseitern!“
Hahn lässt in seinen Erinnerungen nicht aus, dass es eine Zeit der „Abundzubiere“ gab, und ein entscheidendes Erlebnis, das ihm den Alkohol für alle Zeiten vermiest hat. Berührend und poetisch ist es, als er die Mutter ausführen will und sie erst mitkommt, als er sich die Haare wäscht. Später, wenn er die Mutter auf dem Friedhof besucht, wäscht er sich vorher immer die Haare.
Als zu seinem 65. Geburtstag niemand ein Interview mit ihm macht, macht er selbst eines und ist Interviewer und Interviewter zugleich.
Das zeigt Hahns Einsamkeit, aber auch seine Fähigkeit, aus allem zu schöpfen, was ihm widerfährt. Bei seinem Ärger über viel Angestrebtes und Misslungenes, Ungerechtes und zu Unrecht Gehyptes schwebt ein Hauch Ironie über den Sätzen, die immer literarisch sind und die man festhalten möchte. Ob er sich als vorauseilenden Plagiator sieht oder über die Nacht der Bücher philosophiert, in der sie in den Bücherkästen miteinander sprechen wie angeblich die Tiere in der Weihnachtsnacht. Oder von seiner Vorstellung von Glück: „Einmal Schachtel sein und Lieblingsplatz einer Katze werden.“
Je näher er den letzten Seiten in diesem Buch kommt, umso drängender wird die Frage, wie er sich als Ex-Schriftsteller positionieren und managen kann. Es gibt Momente, in denen er sich in Rage schweigt. Und er weiß nach Jahren des Schreibens endlich, wie er ein Schriftstellergesicht machen soll, aber jetzt ist es an der Zeit, sein Exschriftstellergesicht zu üben. Als es dem Ende zugeht mit dem Aufhörbuch, bemerkt er: „Meine Schreibkrise ist, dass ich nicht aufhören kann.“ Er schreibt also gegen das Aufhören an und fragt gegen Schluss ganz leise: „Kann man auch mit dem Aufhören aufhören?“. Je mehr er sich damit beschäftigt, umso schneller kommt die Erkenntnis, dass es ihn mehr Kraft kostet, nicht zu schreiben, als zu schreiben. Und schon auf den letzten Seiten ist zu lesen: „Bis Anfang Mai sollte ich also zu einem Ende kommen mit meinem Aufhören!“
Und es sei hier schon verraten: Auch in diesem und im nächsten Jahr werden Bücher von Friedrich Hahn erscheinen, und ich würde mit ihm wetten, auch wenn es bald 40 sind, es werden nicht die letzten sein.
(Gabriele Kögl, Rezension erschienen im PODIUM #192/193, [Herbst?] 2019)
Gabriele Kögl: [Rezension]
Es ist Ende August 2017. Friedrich Hahn hat zu diesem Zeitpunkt 32 Bücher geschrieben und über 20 Texte und Performances für Hörfunk und Bühne gestaltet. Und trotzdem hat er das Gefühl, dass niemand auf seinen neuen Roman neugierig ist, den er gerade abgeschlossen hat.
Zur Literatur kam er über die Lyrik, mit der er experimentierte, indem er romantisches Gestammel zertrümmerte. Er entdeckte Heimrad Bäckers „neue texte“ und sah, dass es für seine Spielwiese einen Name gab: Konkrete Poesie. Noch vor der Matura erschienen seine „spiegelbilder“ in den „neuen texten“.
Hahn überlegt, seinen Vorlass der Nationalbibliothek anzubieten, und arbeitet seine literarische Vergangenheit auf. Das ist der Ausgangspunkt für die vielen Erinnerungen und Überlegungen in diesem Buch. Und es ist spannend und vergnüglich, Friedrich Hahn dabei zu begleiten. Mit viel Selbstironie, aber auch mit einiger Gekränktheit beschreibt er das Leben mit der schweigsamen Mutter, die ihre Gefühle immer zurückgehalten hat, und dem trunksüchtigen Vater in einer Zimmer-Küche-Kabinettwohnung bis hin zum Besuch des Gymnasiums in der Kundmanngasse, eine Schulbildung, die für ein Eisenbahnerkind nicht vorgesehen, aber durch die Politik Kreiskys möglich geworden war. Seine überbordende Phantasie bringt ihn bald zur Werbung, und Hahn erkennt, wie nahe Werbung und Lyrik beieinander liegen. Er wird Werbedesigner, kreiert Logos für Banken und Versicherungen genauso wie für Verlage, Literaturvereine und Buchhandlungen und versucht ein Leben lang den Spagat zwischen Werbung und Literatur. Hahn erfand die „Wandspielwochen“ mit jeweils 15 bis 20 Plakatstellen über ganz Wien verstreut. Auf türkisem Hintergrund prangte in Grellrot der Sager: „der kunst unter den rock geschaut!“
Er versucht sich auch als Verleger, organisiert die „Dichtermeile“ im 9. Bezirk, ruft als grüner Bezirksrat das Bezirksschreiberstipendium ins Leben und hält Literaturkurse. In einer Schule wird er einmal sogar mit : „Guten Tag, Herr Literatur!“ begrüßt.
„Allerhand Hahn“, wie er bezeichnet wird, ist zu kurz gegriffen für den Tausendsassa, der sofort hundert Ideen hat, wenn er ein Medium zu fassen bekommt. Aber er leidet unter dem Schicksal eines verkannten Generalisten. Er fühlt sich nirgendwo wirklich dazugehörig und sieht sich meist „mittendrin unter Außenseitern!“
Hahn lässt in seinen Erinnerungen nicht aus, dass es eine Zeit der „Abundzubiere“ gab, und ein entscheidendes Erlebnis, das ihm den Alkohol für alle Zeiten vermiest hat. Berührend und poetisch ist es, als er die Mutter ausführen will und sie erst mitkommt, als er sich die Haare wäscht. Später, wenn er die Mutter auf dem Friedhof besucht, wäscht er sich vorher immer die Haare.
Als zu seinem 65. Geburtstag niemand ein Interview mit ihm macht, macht er selbst eines und ist Interviewer und Interviewter zugleich.
Das zeigt Hahns Einsamkeit, aber auch seine Fähigkeit, aus allem zu schöpfen, was ihm widerfährt. Bei seinem Ärger über viel Angestrebtes und Misslungenes, Ungerechtes und zu Unrecht Gehyptes schwebt ein Hauch Ironie über den Sätzen, die immer literarisch sind und die man festhalten möchte. Ob er sich als vorauseilenden Plagiator sieht oder über die Nacht der Bücher philosophiert, in der sie in den Bücherkästen miteinander sprechen wie angeblich die Tiere in der Weihnachtsnacht. Oder von seiner Vorstellung von Glück: „Einmal Schachtel sein und Lieblingsplatz einer Katze werden.“
Je näher er den letzten Seiten in diesem Buch kommt, umso drängender wird die Frage, wie er sich als Ex-Schriftsteller positionieren und managen kann. Es gibt Momente, in denen er sich in Rage schweigt. Und er weiß nach Jahren des Schreibens endlich, wie er ein Schriftstellergesicht machen soll, aber jetzt ist es an der Zeit, sein Exschriftstellergesicht zu üben. Als es dem Ende zugeht mit dem Aufhörbuch, bemerkt er: „Meine Schreibkrise ist, dass ich nicht aufhören kann.“ Er schreibt also gegen das Aufhören an und fragt gegen Schluss ganz leise: „Kann man auch mit dem Aufhören aufhören?“. Je mehr er sich damit beschäftigt, umso schneller kommt die Erkenntnis, dass es ihn mehr Kraft kostet, nicht zu schreiben, als zu schreiben. Und schon auf den letzten Seiten ist zu lesen: „Bis Anfang Mai sollte ich also zu einem Ende kommen mit meinem Aufhören!“
Und es sei hier schon verraten: Auch in diesem und im nächsten Jahr werden Bücher von Friedrich Hahn erscheinen, und ich würde mit ihm wetten, auch wenn es bald 40 sind, es werden nicht die letzten sein.
(Gabriele Kögl, Rezension im Buchmagazin des Literaturhaus Wien vom 29. März 2020)
https://www.literaturhaus-wien.at/review/der-autor-steht-fuer-lesungen-und-pressetermine-nicht-zur-verfuegung-eine-nahaufhoererfahrung/