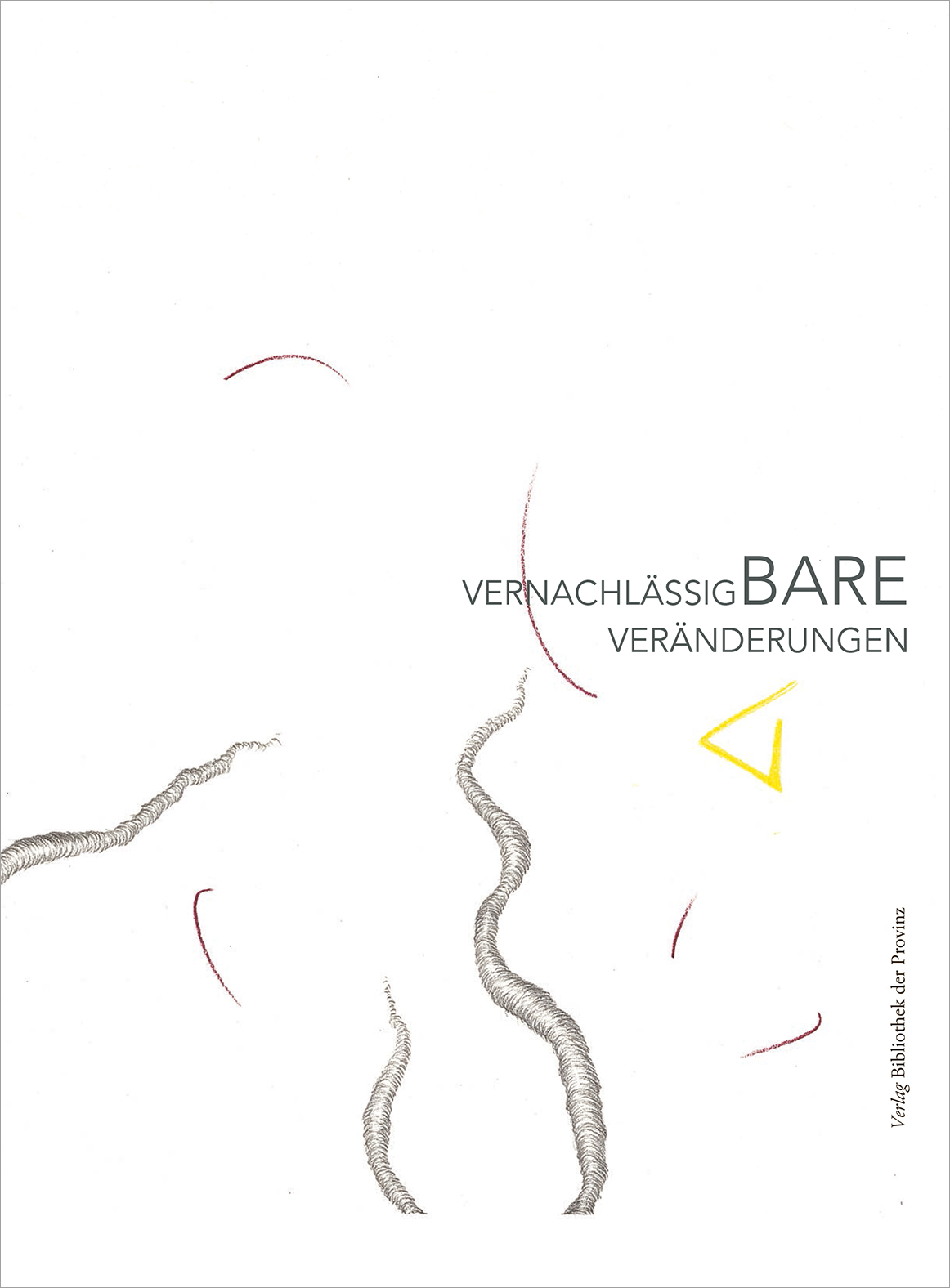
Vernachlässigbare Veränderungen
Bild-Text-Korrespondenz
Kathrin Kloeckl, Elisabeth Klar
ISBN: 978-3-99028-860-3
24,5×20,5 cm, 104 Seiten, m. vierfärbig gedr. Abb., Hardcover
20,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
Körper, die sich in der Gegend verstreuen, sich verselbstständigen oder von uns entfremden. Der Körper und das Verhältnis, in dem wir als Gesellschaft und als Individuum zu ihm stehen, bildet das Leitmotiv des intermedialen Briefwechsels der Schriftstellerin Elisabeth Klar und der Künstlerin Kathrin Kloeckl. Ein Jahr des Dialogs um Veränderungen, die vielleicht alles andere als vernachlässigbar sind.
Malerei, Zeichnung, Bildende Kunst, das ist das Reich der Körper, auf einen Blick sind sie präsent. Prosa und Dichtung, hier ist der Platz für Geschichte und Geschichten; in der Literatur kann sich die Zeit von Buchstabe zu Buchstabe, von Wort zu Wort hanteln. Sicher begegnet uns ein Bild anders als ein Text, aber diese Vorstellung einer klaren Trennung zwischen der Darstellung von Handlung in der Sprache und der Darstellung von Körperlichkeit im Bild ist brüchig. Ganze Epochen können in einer Zeichnung gelesen werden und die fleischigsten, plastischsten Körper aus Büchern steigen.
Elisabeth Klar und Kathrin Kloeckl unterhalten sich, die eine schreibt, die andere zeichnet. Vernachlässigbare Veränderungen denkt damit über die Ausdrucksmöglichkeiten und -grenzen von Wort und Bild nach. Die Leserin kann sich beobachten, wie sie die Zeichnungen und die Texte in Beziehung setzt, wo sie sich wie und wie lange aufhält. Die Frage nach einer Übersetzung steht jedoch nicht im Vordergrund. Die Zeichnungen illustrieren nicht die kurzen Geschichten und Szenen; diese sind wiederum keine Bildbeschreibungen. Das Buch ist ein Dialog, eine chronologisch niedergelegte Korrespondenz zwischen zwei Frauen, die sich persönlich, intellektuell und künstlerisch schätzen und sich etwas zu sagen haben. Am Anfang ihres Gesprächs steht ein vages, aber brodelndes Interesse: Die Darstellung, die Grenzen, die Auflösung, die Multiplizität des Körpers.
Man sagt Identität, und es mischen sich die Zeiten, Kontexte, Selbst- und Fremdbilder und nur mit Ach und Krach rührt man das alles in einem Topf zusammen – und auch immer nur zeitweise. Die Kunst – und im Übrigen auch die Wissenschaft – versucht auf unterschiedlichsten Wegen die Vielheit des Ich herauszustreichen und zu begreifen. Der Körper, dieses plumpe Ding zum Anfassen, wäre ein Trost in dieser Verwirrung: Der Körper als Einheit, unmissverständlich durch die Haut begrenzt, unter unserer Kontrolle. Aber auch diese Vorstellung ist brüchig. Er ist manchmal mehr, manchmal weniger, als man will; manchmal zu starr und unflexibel, manchmal zu flüchtig und undefiniert; manchmal zu nah an seiner Umwelt und an anderen Körpern, manchmal unzugänglich. Wie dann über den Körper nachdenken? Da muss man schon einmal sehr nah an eine Ohrmuschel heran, jede Falte und jeden Knorpel betasten. Da gibt es klare Raster und Linien, aber auch Wirbel ohne klaren Anfang und Ende. Da kann es romantisch werden, rosa, aber auch roh und beunruhigend.
(Julia Grillmayr in der editorischen Notiz)
[Konzept & Gestaltung: Kathrin Kloeckl | Texte: Elisabeth Klar | Zeichnungen: Kathrin Kloeckl]
Rezensionen
Johanna Schwetz-Würth: [Rezension]Üblicherweise schreibe ich Rezensionen zu systemisch-psychotherapeutischer Fachliteratur. Das tue ich nun seit einigen Jahren und habe mittlerweile Übung darin, fühle mich sicher. Nun hat mich meine Kollegin im Wiener Lehrtherapeut*innengremium, Sabine Klar, gebeten doch die Bücher ihrer Tochter, Elisabeth Klar, für die Systeme zu rezensieren – sie fände, so sagte sie mir, diese literarischen Werke höchst anregend für die Psychotherapie.
Üblicherweise mag ich es nicht so gerne meine private literarische Leselust mit meiner beruflichen Brille als systemische Psychotherapeutin zu vermischen aber hier habe ich die Herausforderung angenommen und die beiden Bände mit der Brille der Therapeutin gelesen.
Die in Wien lebende Autorin, Elisabeth Klar, hat sich in den letzten Jahren im deutschsprachigen Literaturbetrieb schon einen Namen gemacht – 4 Bücher hat sie mittlerweile herausgebracht, einige Preise für ihr literarisches Werk bekommen. […]
Eine Bild-Text-Korrespondenz möchte dieses – auch optisch und haptisch sehr ansprechende – Buch sein. Die Autorin schreibt, die Künstlerin zeichnet. Die geschriebenen und gezeichneten Werke beziehen sich aufeinander ohne dass das eine das andere illustriert oder erklärt. Sie regen einander an.
In den sieben Texten von Elisabeth Klar geht es um Körper, Körpergrenzen, dem Auseinanderfallen und Wieder-zusammensetzen, dem Erkennen von Gleichgesinnten bzw. von Mit dem gleichen Problemen durch die Welt Gehenden. Da müssen schon mal hastig Körperteile in der Straßenbahn eingesammelt oder beim Fundbüro abgeholt werden. Ist das nun der eigene oder doch der eines anderen? …. egal… Da bleiben fremde Zehen nach einer gemeinsam verbrachten Nacht auf einem Kasten liegen und so einiges mehr. Die Lesenden finden sich im Kopf eines Menschen mitten im Schlachtfeld wieder oder in dem von jemanden, der in der Früh im Bett den eigenen Körper genussvoll wahrnimmt und sich nicht rühren mag. Literarisch höchst genussvoll geschrieben, in einer Sprache, die mir als Leserin ein Lächeln auf die Lippen zaubert, weil die Sätze, die Worte so kunstvoll und gleichzeitig leichtfüßig aneinander gereiht sind, dass mein Kopf gar nicht anders kann als höchst bizarre Bilder zu entwerfen und bei diese lustvoll zu verweilen.
Das alles kombiniert mit Zeichnungen, die an sich aufgrund ihrer Nicht-Eindeutigkeit dazu anregen, etwas länger dabei zu verweilen um zusehen was es denn da zu sehen gibt und natürlich auch, was das mit den Texten zu haben könnte.
Und ja, mit der therapeutischen Brille betrachtet ist das auch ein ergiebiges Buch. Es kommt nicht so selten vor, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die sich nicht leicht tun zu erkennen und zu spüren, wo der eigene Körper aufhört oder anfängt und wo der des/der Anderen. Wir arbeiten mit Menschen, die immer wieder das Erleben haben, dass ein Teil ihres Körpers wie weg, nicht mehr vorhanden, nicht mehr wahrnehmbar ist und die diese Teile tatsächlich erst mühsam wiederfinden müssen, wir arbeiten mit Menschen in deren Köpfen immer noch Trauma ist. Wir Psy-Profis nennen das dann halt z.B. dissoziativ, eine Definition, die abstrakt bleibt und uns wohl auch in der Distanz zu unseren Klient*innen hält. …aber beim Lesen dieser Texte kamen mir unweigerlich Gedanken zu Klient*innen von mir. Ob es sich nicht vielleicht gerade so anfühlen könnte, ob man/frau es nicht vielleicht gerade auch so erleben könnte. Das regt zum Denken an, das macht auf eine gute Art systemisch neugierig. Eine klare Empfehlung. […]
(Johanna Schwetz-Würth, Rezension in der Fachzeitschrift systeme. Die Zeitschrift für systemtheoretisch Interessierte, [#1/2020?])
