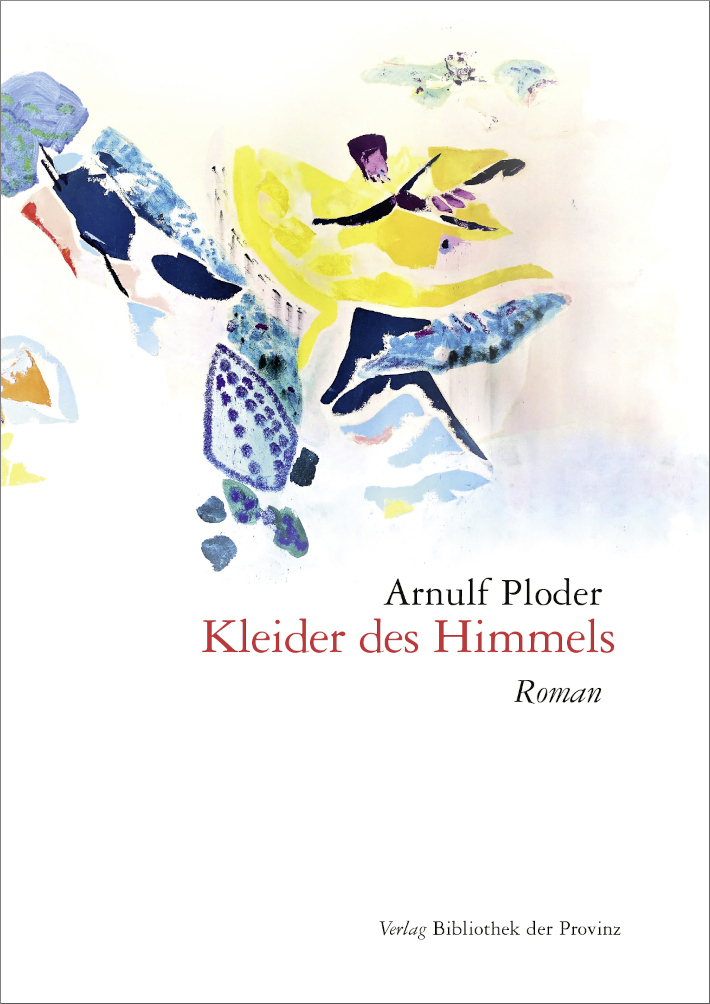
Kleider des Himmels
Roman
Arnulf Ploder
ISBN: 978-3-99028-951-8
21,5×15 cm, 308 Seiten, Hardcover
28,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
Zu Hause nach dem Mittagessen hatte der Vater plötzlich den absonderlichen Einfall, die Küche auszumalen. Auf der Stelle wurde alles mit Zeitungspapier zugedeckt, außer der Bank. Auf der saß ich, einen Mantel übergeworfen, in der Ecke, fröstelnd vor Kälte, die durch die offene Tür hereinkam, während er mit einem Rasierpinsel – etwas anderes besaßen sie nicht – die Wände weißigte. Mir wurde mit der Zeit vom Geruch der Farbe richtig übel und ich bekam Bauchkrämpfe. „Das habe ich jetzt davon, dass ich vorzeitig aus dem Krankenhaus hinauswollte, sagte ich mir.“ Paul legte seine Hand tröstend auf jene der Mutter. „Es wurde bereits dunkel, und es war noch kein Ende abzusehen. Am späten Heiligen Abend, waren die Wände dann endlich fertig gestrichen.“
„Sein Vater hatte sich damals wohl auf seine Art die Zukunft ausgemalt“, dachte Paul.
Mehr für sich flüsterte er: „Weiße Weihnachten …“
Der Titel „Kleider des Himmels“ als poetisches Bild für die Wolken ist eine Entsprechung für die schwankende Stimmungslage von Agnes, der Protagonistin des Romans, die in den kurzen Pausen zwischen den Katastrophen ihr Fortkommen sucht.
Für Agnes sind die „Kleider des Himmels“ der Sehnsuchtsort, eine wirkungsmächtige Zufluchtsstätte: „Manchmal wünsche ich mir so sehr, dass mich eine der Wolken dort oben still und leise fortträgt…“
Dieses „Dokument“ einer Frau und Gattin „mit schönen glänzenden dunklen Augen“, die vergeblich versucht ihr Leid dadurch erträglicher zu machen, dass sie sich mitunter einen sanften Tod erhofft, der sie aller bangen Sorgen entledigt, soll das Dasein in einem Licht schildern, das nur noch in ihren Wachträumen seine einstige (kleinbürgerliche) Pracht entfalten kann.
Die beiden „gebrochenen“ Frauen, Helene (Mutter von Martin, dem Gatten) und – ungleich mehr – Agnes (Mutter der beiden Kinder Paul und Regina, sind Menschen, die sich ihrer misslichen Lage zwar b ewusst sind, aber einfach zu wenig Kraft und mangelnde Unterstützung haben, um ihre Last abzuschütteln und der seelischen Bedrückung und ihrer „Prädestination“ halbwegs unbeschadet zu entkommen.
Paul und Hanna, die jungen Liebenden des Romans, selbst zugleich Getriebene und Opfer, leben das aus bzw. führen fort, was sie als „Idealzustand“ einer Beziehung jeweils vorgelebt bekommen; und ihnen gelingt es auch als Studierende nicht, sich der Fesseln gesellschaftlicher Konventionen zu entledigen. So setzt sich unter umgekehrten Vorzeichen fort, was sie von ihren Eltern „ererbt“ haben.
Rezensionen
Karin Waldner-Petutschnig: Ein Familien-Porträt in GrautönenArnulf Ploder schildert ein Frauenleben zwischen Erdenschwere und Sehnsucht.
Weil Frauen oft so viel aushalten müssen, um eine Familie zusammenzuhalten. Der Mann ist ja bald einmal weg“, erzählt Arnulf Ploder von seinen Beweggründen, einen Roman über zwei Frauenschicksale zu schreiben. Von der ständig kränkelnden, an unerfüllten Hoffnungen und ihrem untreuen Mann leidenden Agnes und von Helene, ihrer Schwiegermutter. Und auch die dritte, junge Generation in Gestalt der Kinder Paul und Regina scheint sich nicht aus dem familiären Muster aus Abhängigkeit und Kleinmut lösen zu können. Es ist ein Familienporträt in Moll, das der Autor entwirft. Langsam und über mehrere Jahre erzählt er vom kleinbürgerlichen Leben und Träumen in der Provinz, von abwesenden Männern und depressiven Frauen. Wie er das tut, ist lakonisch und nüchtern, „an Stifter geschult“, wie er im Gespräch selbst sagt. Die Gefühle brodeln unter der Oberfläche, doch ab und zu durchbricht Poesie den Protokollstil: „Zu dritt gingen sie nach oben: die kleinen Schweigestill und Sagjanichts und eine Leidefroh.“ Den Titel für seinen ersten Roman leiht sich Arnulf Ploder, Preisträger des Lyrikwettbewerbes der Klagenfurter Stadtwerke 2019, von William Butler Yeats, bei dem es in einem gleichlautenden Gedicht heißt: „… hab nur meine Träume. Die legte ich zu deinen Füßen aus, tritt sanft, du trittst ja auf meine Träume.“
Mit den Wolken, den „Kleidern des Himmels“, zieht die Sehnsucht nach Glück für Agnes dahin. Und die Erdenschwere des Alltags drückt sie zu Boden. Der Autor, pensionierter Deutsch- und Philosophielehrer in Klagenfurt, ist ein genauer Beobachter, der ohne Pathos aber mit viel Empathie für seine Figuren persönliche Schicksale entwirft.
(Karin Waldner-Petutschnig, Rezension in der Kleinen Zeitung Ausgabe Kärnten vom 19. Oktober 2020)
Katharina Herzmansky: Epochenroman
In seinem Romandebüt erzählt Arnulf Ploder von Kindheit und Adoleszenz in einer österreichischen Kleinstadt der 1960er bis 1980er Jahre, von einer Generation, die Krieg und Nachkriegssituation nicht mehr unmittelbar erlebt hat, sondern in einer Zeit einsetzenden Aufschwungs großgeworden ist. Als Montage erinnerter Bilder, Szenen und Dialoge lässt er die Geschichte einer Familie entstehen, deren Oberhaupt ein lebenspraktischer Vater und notorischer Fremdgänger ist und deren Mutter an psychischen wie physischen Krankheiten langsam zugrunde geht. Im Zentrum stehen der Sohn Paul und die Strategien, die er im Umgang mit der spezifischen Situation entwickelt, sowie deren Auswirkungen auf das eigene Erwachsenenleben. Besonders einnehmend sind die Beobachtungen von Details – Interieurs, Ausstattung, Gesten oder Usancen –, die die Alltagswelt ebenso dokumentieren wie in ansprechenden Bildern gleichsam transzendieren; selten hat man auch so überzeugend von Sexualität gelesen. Wiewohl die zentrale Perspektive dem jungen Protagonisten gilt, wertet die auktoriale Instanz nicht, sondern wird gerade durch die unprätentiöse, melancholisch grundierte Betrachtungsweise zur Verfechterin von Gleichberechtigung und Selbstbestimmung. Schade, dass dem Buch nicht jene editorische Sorgfalt zuteilwurde, wie man sie vom Verlag an und für sich gewohnt ist.
(Katharina Herzmansky, Rezension in Die Brücke, Nr. 21, Brückengeneration 5, Dezember 2020/Jänner 2021, S. 47)
Eva Possnig-Pawlik: [Auf dem Nachttisch von Elisabeth (sic) Possnig-Pawlik liegt …]
[…] Eine weitere Empfehlung betrifft das Romandebüt „Kleider des Himmels“ des Klagenfurter Autors Arnulf Ploder, der 2020 im Verlag Bibliothek der Provinz erschienen ist.
Er erzählt die Lebenswirklichkeit einer österreichischen Kleinfamilie der 60er bis 80er Jahre. Die Konflikte zwischen den Eltern und die schwere Erkrankung der Mutter überschatten das Aufwachsen der beiden Kinder. Paul und Regina finden neue Kraft und Zuversicht in der Obhut der beherzten Großmutter.
Ploder erzählt poetisch und in einem einzigartigen, zurückhaltenden Sprachstil.
(Eva Possnig-Pawlik, Rezension im Literaturnewsletter der Kleinen Zeitung Graz vom 27. Feber 2021)
Walter Fanta: [Rezension]
Requiem für eine Mutter. „Kleider des Himmels“ ist ein Familienroman, ein Frauenroman, ein Sozialroman. Mit erbarmungsloser Genauigkeit bringt die Schilderung Licht in einen oft heiteren, oft grausamen Familienalltag der 1950-er bis 1970-er Jahre in der österreichischen Provinz. Es geht um drei Generationen, in der Mitte steht Agnes, die kleinbürgerliche Ehefrau und Mutter, mit Rückblenden auf das Schicksal der Frauengeneration davor, bis in die Zeit des Ersten Weltkriegs, in Gestalt der Schwiegermutter Helene. Arnulf Ploder hat sich einen strengen, aber gerechten sozialpsychologischen Blick anerzogen; ohne Schonung berichtet er von der strukturellen und personellen Gewalt, die in Familien herrscht. Die Männer errichten wie selbstverständlich ausgeklügelte ökonomische Abhängigkeitsverhältnisse. Weiblichkeit wird als Defizit gezeigt: Der Körper, die Sexualität als Machtmittel, als Zwang, als Last. Das Licht, mit dem der Erzähler dieses Romans die Verhältnisse grell ausleuchtet, ist seine Sprache. Es scheint, als wäre sie eigens dafür erfunden, um die manchmal kaum noch erträgliche Realität zu penetrieren. Wie eine Sonde fährt diese Sprache durch die Eingeweide intimer familiärer Verhältnisse. Die Menschen bekommen ihre Kontur durch die alltägliche Sprache, die sie sprechen, und durch die vielschichtige Erzählsprache, die von ihnen spricht. Direkte Reden wechseln mit Erlebten Reden aus der Perspektive des Sohnes Paul und mit eingeschobenen Texten aus der Kindheit der Mutter und der Jugend der Großmutter. Diese Sprache tut oft weh! Die Phrasenhaftigkeit kehrt das eingeschränkte Bewusstsein der Personen und die Banalität des Alltags nach oben. Das Defizitäre der Sprache geht einher mit Alltagsverliebtheit, das Benennen der vielen kleinen Dinge wird zur Sucht, die aber in all ihrer Zwanghaftigkeit beim Lesen einen hohen Wiedererkennungswert erzeugt. Das Verfahren nimmt eine literarische Tradition wieder auf, die in der Jugend des Autors en vogue war: Franz Innerhofer, Gernot Wolfgruber, die junge Elfriede Jelinek. Im Mittelpunkt steht der Kampf einer Mutter gegen die Krankheit, gegen die Dinge, die sie haben krank werden lassen – getragen ist diese schonungslose Beschreibung von einem bis in letzte Gründe reichenden Verständnis.
Ende des Schweigens. Nach langer Pause vermochte Arnulf Ploder sein teils vom Schuldienst erzwungenes, teils seiner Akribie geschuldetes Schweigen zu beenden; er beeindruckte die Öffentlichkeit mit Auftritten in den drei Hauptgattungen: 2010 erlebte sein Theaterstück „Gegenliebe“ an der Studienbühne Villach unter der Regie von Manfred Lukas-Luderer die Uraufführung. Das Drama beschreibt Familienstrukturen in der für ihn typischen Mischsprache aus größter Nähe zum alltäglichen Sprechen und poetischer Verfremdung; sie taucht ein in das Leben einer Familie, wo Sehnsucht, Kälte und Distanz herrschen und Liebe bloß als Floskel existiert. Im November 2019 erhielt der „Wortakrobat“ Arnulf Ploder den 12. Kärntner Lyrikpreis der Stadtwerke Klagenfurt, nachdem er mehrere Anläufe genommen hatte, diese Auszeichnung zu erringen, für „seine besonderen Sprachschwingungen“. Das Stück und die Gedichte weisen auf den Roman voraus, an dem er schon längst schrieb, in den Themen und bis in die Formulierungen. Erst die Pensionierung im Sommer 2019 öffnete die Bahn für die Fertigstellung dieses Projekts, im Frühjahr 2020 konnte das Buch im Verlag Bibliothek der Provinz – mitten in der Pandemie – schließlich erscheinen; tragischerweise wurde der Roman zum Requiem Arnulf Ploders, zum Requiem für eine Mutter.
Nachruf für einen ungewöhnlichen Autor. Für Jahrzehnte bildete Arnulf Ploder – geboren am 1. September 1955 in Graz, früh verstorben am 25. August 2021 – den heimlichen Mittelpunkt der Klagenfurter Literaturszene. Er war in der Landesgruppe der Grazer Autorinnen Autorenversammlung und der IG Autorinnen Autoren aktiv und stand auch dem Kärntner Schriftstellerverband zeitweise nahe. Mit seiner bescheidenen und sachlichen, wenn es sein musste aber bestimmten Art trat er als Vermittler und Schlichter hervor. Sein fulminantes literarisches Entree lag lange zurück; 1986 hatte er beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb den Ernst-Willner-Preis gewonnen. Man erkundigte sich: was schreibst? Er pflegte mit den Achseln zu zucken: die Schule. Arnulf Ploder unterrichtete Deutsch am Mössinger-Gymnasium, und er tat das mit Herz und Hirn. Die Begeisterung für Literatur bei jungen Leuten zu wecken, damit verdiente er sein täglich Brot, das war sein Dienst an der Literatur, in unnachahmlich unaufdringlicher Weise – ich war selbst mehrfach Zeuge in einer seiner Klassen! Er drängte die Literatur den Schüler*innen nicht auf. Er war auch sonst, in jeder Begegnung, einer, der sich zurücknehmen konnte, sehr ungewöhnlich für Lehrer, und für Schriftsteller.
(Walter Fanta, Rezension im Online-Buchmagazin des Literaturhauses Wien, veröffentlicht am 23. September 2021)
https://www.literaturhaus-wien.at/review/kleider-des-himmels/
