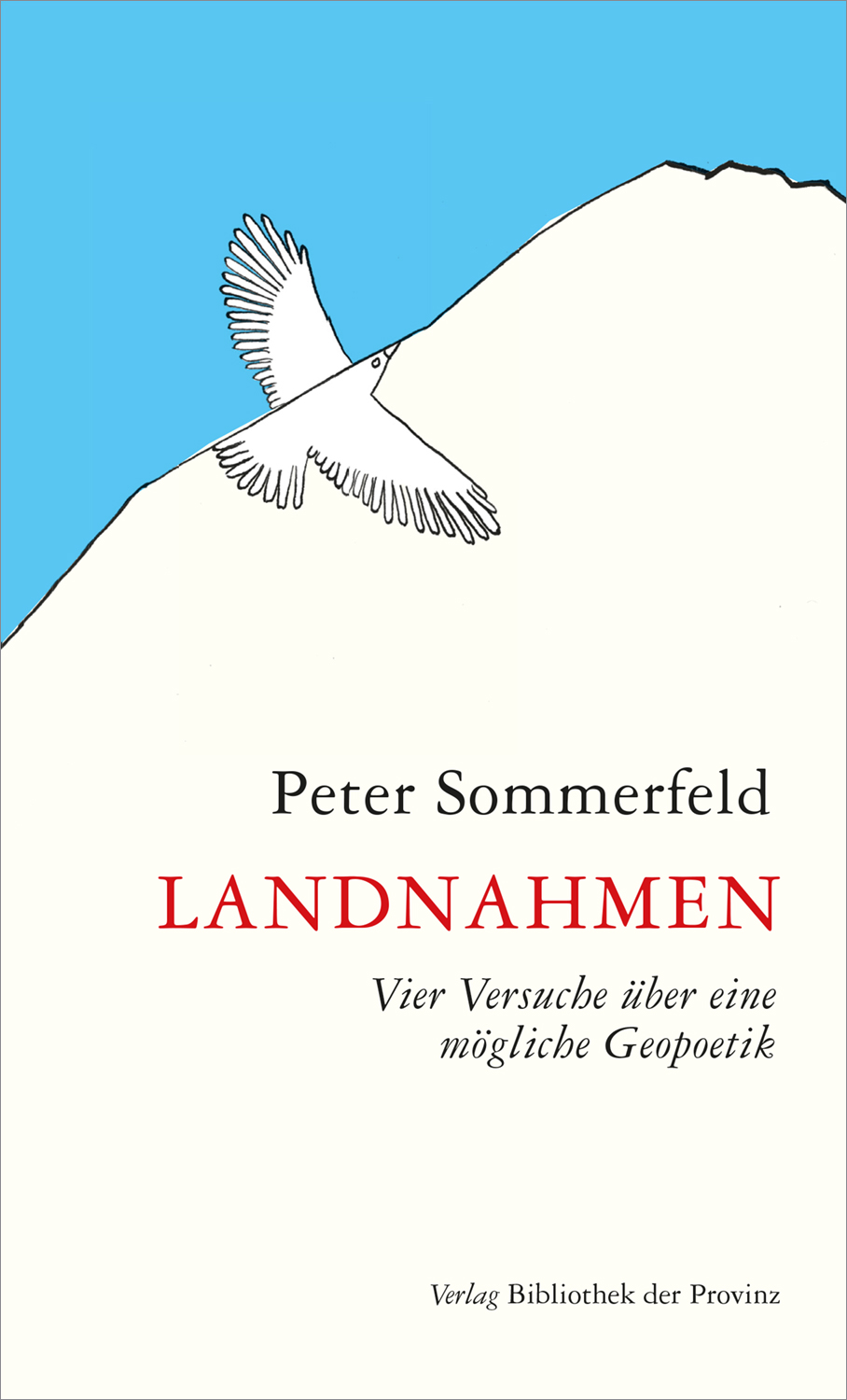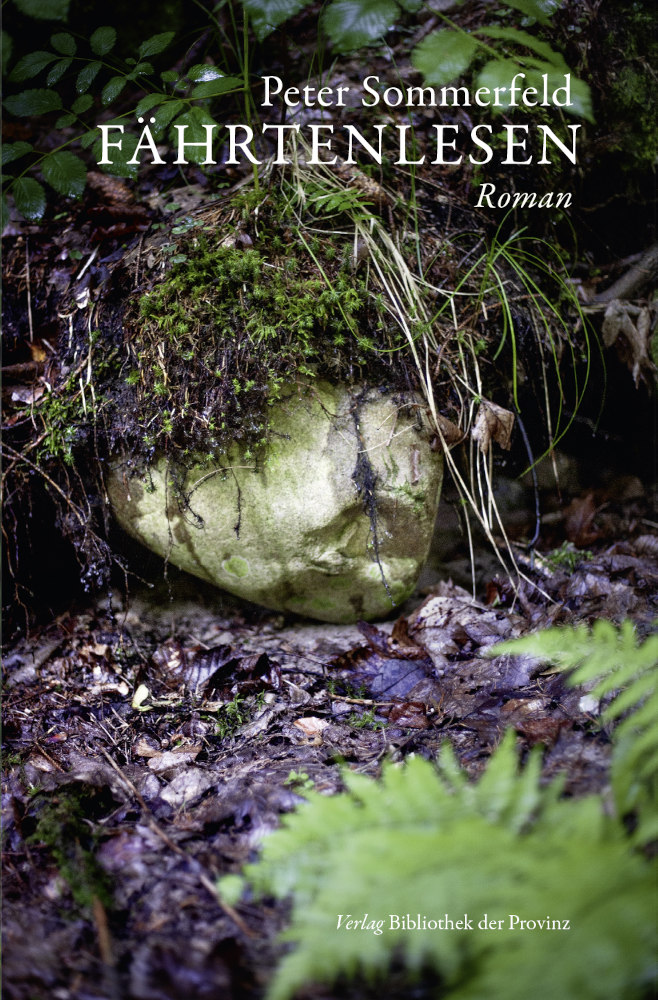
Fährtenlesen
Roman
Peter Sommerfeld
ISBN: 978-3-99028-926-6
19×12,5 cm, 304 Seiten, m. Abb., Klappenbroschur
28,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
Ein Mann und eine Frau brechen in den Luberon im Süden Frankreichs auf, die Gedichte des französischen Poeten und Widerstandskämpfers René Char (1907–1988) im Gepäck. Von den Gerüchen des kargen Landstrichs eingekreist, geraten sie ins Netz der dortigen Geschichten, in denen sich Vergangenes und Gegenwärtiges verschränken.
Bei ihren Fahrten übers Land haben sie einen ständigen Begleiter: die mythische Figur des großen Jägers Orion. In ihm begegnen sich zwei Formen des Gewaltsamen. Das unverfügbar Gewaltsame im Wilden der Natur – aller Technik zum Trotz – und das verfügbar Gewaltsame in den Händen des Menschen, das aufblitzt in jenen Rissen und Spalten der Zeit, wo Entscheidungen möglich werden, die in letzter Instanz gebieten können über Grauen oder Glück.
Vielleicht ist es die Reibungszone zwischen zwei Fragen, die die Figuren in diesem Roman umtreibt. Erstens, ist Gewalt des Menschen gegen seinen Mitmenschen rechtfertigbar? Zweitens, wozu Gedichte?
Rezensionen
Richard Wall: Der Dichter im MaquisPeter Sommerfeld spürt in seinem Roman „Fährtenlesen“ dem Lyriker und Résistance-Kämpfer René Char nach.
Ich könnte mit Anne Beaumanoir beginnen, die im vergangenen Jahr durch das von Anne Weber verfasste Heldinnenepos bekannt geworden ist, eine Maquisarde, die ebenfalls in der Résistance gekämpft hat. Oder mit Francis Curel, der aus dem Süden Frankreichs in das KZ Mauthausen verschleppt wurde und überlebt hat. Aber das führte zu weit ins Dickicht des Maquis, wo die Macchie-Pflanze „kriechend ihre Renitenz auswächst“. Curel, der Sohn eines Kommunisten und Schleusenwärters, kam nämlich aus derselben Kleinstadt in Südfrankreichs wie die Person, um die der Roman „Fährtenlesen“ von Peter Sommerfeld angelegt ist: René Char, Dichter und Widerstandskämpfer.
Zum Verständnis des Folgenden ein paar Fakten: 1907 in L’Isle-sur-la-Sorgue im Département Vaucluse geboren, sind Handwerker, Landstreicher, Zirkusartisten und Schausteller die Gefährten und Bezugspersonen seiner Jugend (sein Vater stirbt, als er zehn ist). Sie, die er später als „les matineaux“, als „die Transparenten“ benennen wird, nomadisierende Figuren, die trotz einer erschütternden Erfahrung oder Niederlage bereit sind, weiterzuwandern, unterrichten ihn als Erste über das Leben im Freien und Ungewissen.
Als 22-Jähriger bricht er nach Paris auf und schließt sich der surrealistischen Bewegung an, die er 1937 wieder verlässt. 1939 einberufen, geht er 1940 in den Untergrund und kämpft mit einer Gruppe von Männern in der Provence gegen die deutsche Besatzung. Das Leben im Maquis, festgehalten auf 500 Seiten, verwandelt Char in die Prosa „Feuillets d’Hypnos“, die 1946 von Albert Camus veröffentlicht und von Paul Celan 1959 ins Deutsche übertragen wird.
Poet und Partisan
René Char war von hünenhafter Erscheinung, dennoch ein sensibler und genauer Beobachter. Den Wesen und Formen der Natur näherte er sich im Bewusstsein einer fragilen Spannung zwischen den Elementen. Seine Gedichte, so abstrakt sie auch beim Erstlesen erscheinen mögen, zeugen zugleich von einer Gegenständlichkeit, aus der eine tiefe, seit seiner Kindheit wachsende, durch die Jahre im Maquis intensivierte Verbundenheit zu der Region seiner Geburt und zu deren Aromen spricht.
Im Roman „Fährtenlesen“ von Peter Sommerfeld, der 1996 mit der essayistischen Erzählung „Landnahme. Vier Versuche über eine Geopolitik“ debütierte, begibt sich ein Paar, Mann und Frau, in die einstige Heimat des Poeten und Partisanen, um – wie der Titel schon sagt – Spurensuche zu betreiben. Mit der umfangreichen Lyrik von Char im Gepäck und mit dem Wissen um biographische Details ausgestattet, versuchen sie, ihm und seiner Dichtung in der Landschaft seiner Jugend und seines Widerstands noch um eine Spur näher zu kommen. Manchmal ist es ja tatsächlich so, dass sich das Werk eines Schriftstellers an jenem Ort, an dem es entstanden ist, beim Wiederlesen verändert, oder dass es gelingt, ihm eine erfrischendneue Intensität abzugewinnen.
Das Umfeld des Romans ist le maquis, die undurchdringliche, dornige für Mittelmeerländer typische Buschvegetation: Über die Jahrhunderte hielten sich in ihr Gesetzlose versteckt, doch zur Zeit der deutschen Besetzung Frankreichs wurde der Begriff das Synonym für die Partisanenbewegung. Die Roman-Form gibt dem Autor die Möglichkeit, die Annäherung an den Dichter, die man als Hommage bezeichnen darf, wesentlich anders anzugehen als in einem Essay. Es liegt von Anfang an ein Hauch von Geheimnis in den Sätzen, etwas Unbestimmt-Ahnungsvolles schwingt stets mit. Nahezu jedes Kapitel ändert den Blickwinkel, den Ort oder die Zeit des Geschehens. Die Leserin, der Leser wird zum Fährtenlesen mitgenommen, auf eine erlebnisreiche Reise, die durch Schluchten führt und vorüber an Abgründen, auch menschlicher Art, und immer wieder zur Poesie René Chars zurückkehrt.
Auf der Suche nach dem „Maison René Char“ in der Geburtsstadt des Dichters müssen die beiden Hauptfiguren gleich einmal erkennen, dass daraus ein Kunstmuseum wurde, das eine Schau zur Geschichte der Fotografie ausgerichtet hat. Der politische Rechtsruck in der Provence, das Erstarken des Front National hat möglicherweise zu einer Namensänderung geführt; das Haus nennt sich nun Campredon Centre d’art.
Die Sammlung zum Dichter hat die Witwe Marie-Claude Char bereits wenige Jahre nach Eröffnung des Hauses, die 2003 erfolgte, und offensichtlich kurz vor dem Eintreffen der Spurensucher aus dem Norden wieder abgezogen. Die Kommune habe die Verabredung gebrochen, dass nämlich die Präsentationen sich auf Werk und Leben ihres 1988 verstorbenen Mannes beziehen sollten. Nach Ausstellungen über befreundete Autoren und Künstler wie Paul Eluard, Albert Camus, Alberto Giacometti, Miro oder Picasso wurden jedoch Dinge gezeigt, die mit dem Poeten, Surrealisten, Résistance-Kämpfer und dem Maquis nichts zu tun hatten.
Die Frau an der Kassa gibt vor, den Namen René Char noch nie gehört zu haben. Sie fühlt sich düpiert, belehrt von Nichtfranzosen, die auf ein Schild mit dem Namen „Alexandre“ verweisen, das sich noch im Foyer befindet: Oberhalb ein leerer Fleck, heller als die Mauerfärbung der Umgebung, denn hier hing ein Porträt von Char, der im Widerstand „Capitaine Alexandre“ genannt wurde. Im ersten Stock finden sie in einem abgelegenen Zimmer noch Reste der Schau zu Chars 100. Geburtstag im Jahre 2007. Geschrieben ist dieses Kapitel aus der Perspektive der Frau an der Kassa, deren Bewusst- und Unterbewusstsein noch länger mit den Poesie-Touristen beschäftigt ist, zumal sie mit diesen später noch einmal zusammentrifft und es schließlich so weit kommt, dass sie gemeinsam das Grab des Poeten aufsuchen wollen.
Die inneren Monologe, die den Roman auszeichnen, zeigen das Gespür des Autors Sommerfeld, der im Brotberuf als Therapeut arbeitet, für die Psychologie der Personen. Wie Sommerfeld dem alten Bäcker ein Erlebnis seiner Kindheit erzählen lässt, in Etappen, wie dieser als Kind, auf eine Platane geklettert, das Eindringen einer Einheit der deutschen Wehrmacht in sein Heimatdorf schildert, ist ein Meisterwerk an Entwicklungspsychologie und Veranschaulichung.
Leben im Widerstand
Der Erzähler erinnert sich, wie der Alltag von Familien, die auf Seiten des Widerstands lebten, verstörend oder rätselhaft auf Kinder gewirkt habe. Sie durften von der politischen Position der Eltern nichts wissen, denn es sei vorgekommen, dass auch Kinder von der SS oder Angehörigen der Wehrmacht gefoltert wurden, um Informationen zu bekommen. „Und dann die Kollaborateure. Bei manchen Leuten im Dorf hätte man nicht gewusst, auf welcher Seite sie stünden. Das Zusammenleben im Dorf sei von Geheimnissen und Abgründen durchwebt, ja geradezu durchdrungen gewesen. Schweigen war wichtiger als das Gespräch.“
In einer historischen Rückblende wird der Nachtflug eines britischen Piloten geschildert. An einer genau gekennzeichneten Stelle und verdeutlicht durch Lichtsignale versorgt er die Kombattanten im Maquis. Verpackt in Kisten, schwebt das Angeforderte an Fallschirmen zu Boden.
Der Einsatz gelingt, und auf dem Rückflug über das Mittelmeer in den Maghreb kommen dem jungen Piloten Erinnerungen an seine Schulzeit. Er vergegenwärtigt sich das Bild einer Lehrerin, die auf den Jugendlichen eine erotische Anziehungskraft ausgeübt hat und wie er – nicht zuletzt durch dieses Spannungsverhältnis beflügelt – ihren Literaturunterricht konzentriert aufnehmen konnte. Er erinnert sich so der Verse aus Percy Bysshe Shellys Poem „Laon and Cythna“.
Eine von Sommerfeld nicht zufällig ins Spiel gebrachte Korrespondenz mit der Situation sowohl des Piloten als auch der Partisanen. Das einst gefeierte Werk des englischen Dichters, das nahezu fünftausend Verse umfasst, ist einerseits eine philosophische Abhandlung als auch eine Liebesgeschichte. Es folgt den Gedanken und Abenteuern eines Geschwisterpaares, das, angetrieben von sozialistischen, feministischen und ökologischen Idealen, einen politischen Aufstand entfacht und schließlich auf dem Scheiterhaufen endet.
Alles im Fluss
Auch im Roman entstehen mit und zwischen den Personen, die das spurensuchende Paar kennenlernt, immer wieder Konstellationen, die auf eine andere Weise die Geschlechterspannung zwischen Mann und Frau zur Sprache bringen. Sowohl das Poetische als auch unsere Existenz ist permanent Gefahren ausgesetzt, das Aufblitzen eines Mündungsfeuers – ich nehme das Bild als Synonym für Krieg und Gewalt – ist eine ständige Bedrohung.
René Char nahm als Partisan den Widerstand auf. Am Ufer der Sorgue geboren, die im Karst der Vaucluse entspringt, hatte er seit seiner Kindheit ein Fließen vor Augen. Auf dieses Panta rhei des Philosophen Heraklit sowie auf die Vier-Elemente-Lehre der Antike bezieht sich Char immer wieder in seiner Dichtung.
Die Wochen im Luberon werden für die beiden Fährtenleser aus dem Norden – so viel wird bald klar – kein Ferienaufenthalt, denn die Spaziergänge und -fahrten führen sie in ungeahnte Traumgespinste und tatsächlich, wie erhofft, tief an die komplizierte Existenz des Dichters heran, der gegen Ende seines Lebens immer mehr Grenzen überschreitet und wahnsinnig wird.
Verwoben wird das Erzählen mit essayistischen, Querverbindungen herstellenden Passagen. Zudem bietet ein ausführlicher „Fährtenapparat“ zusätzlich Hinweise, Zitate und Quellenangaben. Ein in sich schlüssiges Werk, das die Fabulierlust, die Obsession für Details nicht verbirgt. Ja, Sprache kann mehr, als manche ihr zutrauen.
(Richard Wall, Rezension erschienen in der Wiener Zeitung vom 4. September 2021, S. 34)
https://www.tagblatt-wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/literatur/2118839-Der-Dichter-im-Maquis.html