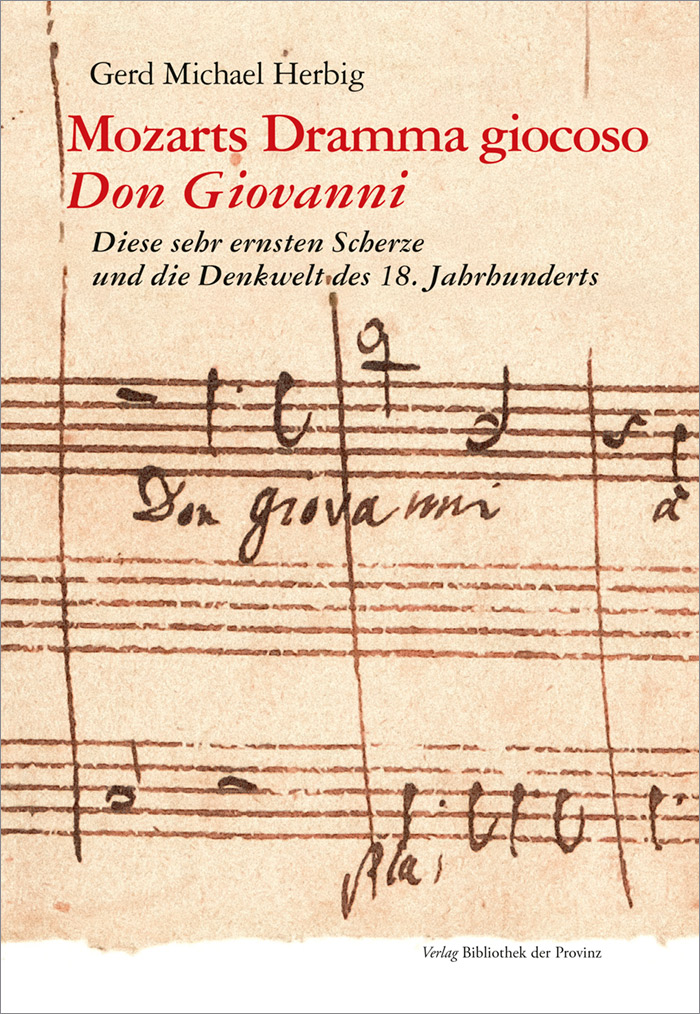
Mozarts Dramma giocoso ‚Don Giovanni‘
Diese sehr ernsten Scherze und die Denkwelt des 18. Jahrhunderts
Gerd Michael Herbig
ISBN: 978-3-99126-222-0
24,5×17 cm, 688 Seiten, zahlr. Notenbeisp., Hardcover m. Lesebändchen
40,00 €
Neuerscheinung
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
Gerd Michael Herbig hat ein faszinierendes Buch geschrieben, das allen Mozartkennern und Mozartliebhabern neue Erkenntnisse über historische Zusammenhänge, biographische Bezüge und Werkanalyse bietet. Ausgehend von Mozarts Oper „Don Giovanni“ gelingt ihm ein grandioser Abriss über Zeitbezug und Wesen Mozart‘schen Schaffens. Dies Buch sollte Pflichtlektüre sein für Dirigenten, Sänger und Sängerinnen, Regisseure und alle, die über das Genie Mozart umfassend informiert sein wollen.
(Kammersängerin und Intendantin Brigitte Fassbaender)
ich kann nur jedem regisseur, der sich mozarts werk vornimmt, gerd michael herbigs werk empfehlen.
(peter konwitschny, antichrist der freunde der toten oper)
Als ich zum ersten Mal die Ouvertüre von Mozarts Don Giovanni hörte – in einem Internat in Salzburg, dessen Strenge durch einige Menschen soweit gemildert, dass seelisches Überleben möglich war; einer davon der Pater, der den Musikunterricht gab – vermutlich dreizehn Jahre alt, war ich mit Sicherheit schon vorher in der Getreidegasse vor Mozarts Geburtshaus gestanden. Aber, aus einer relativ bildungsfernen Mittelschichtsfamilie herkommend, war Mozart für mich ein Unbekannter. In diese ahnungslose, aber auch durch nichts verstellte Leere brachen nun diese seltsam verschobenen Akkorde des Beginns ein, verstörend, das, was ich bislang unter »schön« verstanden hatte, völlig in Frage stellend, eigentlich zertrümmernd. Sicher spukten in meinem Kopf die damals geläufigen Wörter: »apollinischer Mozart«, auch wenn mir dieses »apollinisch« nichts sagte, aber konnte es dieses sein? Dieses tastende Verhängnis, das sich in seltsamen Synkopierungen schlangenartig knäuelte und aufbäumte?
Vielleicht wird in diesen Andeutungen verständlich, warum mich diese Musik nie mehr losgelassen hat, gerade wegen dieser völlig unbegriffenen Überwältigung des ersten Hörens.
Und langsam wuchs das dazu, was man Erfahrung nennt: Studium, Leben, Lieben, Verirrungen und Verwicklungen, und immer wieder diese Musik.
Einmal las ich den Satz Rilkes, dass Verse, und dies gilt auch für Musik, nicht Gefühle sind – »es sind Erfahrungen.«
Und dann war ich unversehens 35 Jahre alt. Für Dante bedeutete dieses Lebensalter die Krise »nel mezzo del cammin di nostra vita«, für Mozart den Tod. Hatte ich auch nur annähernd so viel Leben in mich aufgenommen? Von verarbeiteter Erfahrung ganz zu schweigen.
Diese Erfahrungsdichte Mozarts! Und so angezogen von diesem stärkeren Dasein begann nun das, was letztlich zu diesem Buch geführt hat.
Ich weiß, dass Mozarts Kunst mein Leben verändert hat.
(Gerd Michael Herbig in der Vorbemerkung)
Rezensionen
Volker Tarnow: [Reaktion]Lieber Michele Herbig,
[…] Dein Buch [ist], soweit ich das überblicke, die wichtigste Publikation zu Mozart überhaupt. Mein Gott, mit was hat man sich bisher abgegeben – Dieckmann, Kunze usw. – und wieviel ist bis heute ungesagt, unbegriffen, ungeahnt!
Es wird keine substantielle Mozart-Rezeption mehr geben, die an Deinem Werk vorbeigeht, davon bin ich überzeugt. Es dürfte auch unmöglich sein, etwas Ähnliches über Tristan, Elektra oder Wozzeck zu schreiben, ja nicht einmal über Figaros Hochzeit. Dein Don Giovanni stößt in eine ganz neue Dimension vor. Du hast, um es pathetisch zu sagen, Deinen Namen unsterblich gemacht.
Ich gratuliere und danke Dir,
Volker Tarnow
Volker Tarnow: Ein Opfer reaktionärer Romantik
In einem epochalen Werk erklärt Gerd Michael Herbig die Oper «Don Giovanni» und korrigiert das bis heute virulente Mozart-Bild
Kann es sein, dass wir von Mozart wenig verstanden haben? Dass seit der Uraufführung des «Don Giovanni» bis auf unsere Tage vorwiegend Irrtümer und ideologische Verfälschungen die Runde machen? Wer das mit kühnen Thesen aufwartende Buch von Gerd Michael Herbig studiert, kommt unweigerlich zu diesem Schluss. Die einzigartige Komplexität des Werkes ist bislang nur ansatzweise durchschaut, seine manifeste Botschaft mutwillig oder aus blanker Ahnungslosigkeit ins Gegenteil verkehrt. Eine Phalanx prominenter Autoren von E. T. A. Hoffmann und Søren Kierkegaard bis Hans Mayer und Wolfgang Hildesheimer hat nolens volens die Unwahrheit zum hermeneutischen Prinzip erhoben. Herbig spricht von Denkverweigerung – und demonstriert auf 650 eng beschriebenen Seiten (im Lexikon-Format DIN B5), wie Musik und Text zu analysieren sind, nimmt man Mozart und Lorenzo da Ponte ernst.
Die Bibliographie umfasst 850 Titel. Der Fokus liegt auf französischen und deutschen Aufklärern; poetische, philosophische und musiktheoretische Veröffentlichungen des 18. Jahrhunderts werden zu Rate gezogen – also das Mozart verfügbare Wissen – und durch Publikationen moderner Autoren gestützt, unter ihnen Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Jan Assmann, Paul Virilio und George Steiner. Tiefe Intuition und empathisches Einfühlungsvermögen befähigten Mozart, führt Herbig aus, das Wehen des Zeitgeistes zu erspüren. Auch wenn er nicht die Enzyklopädisten las, nicht Lessing und Herder, vielleicht nicht einmal das «Journal der Freymaurer», war er doch über die Tendenzen der wichtigsten Essays und Traktate orientiert. Er bewegte sich viele Jahre, zeitweilig sogar tagtäglich in jenen Kreisen, deren Mitglieder den philosophischen Diskurs der Aufklärung prägten. Ohne diesen ideengeschichtlichen Hintergrund sind seine Bühnenwerke nicht zu begreifen.
Mozart war vom Vater her mit Werken Wielands und Gellerts vertraut; Leopold bemühte sich auch, ihm musiktheoretische Schriften von Fux, Marpurg, d’Alembert und Rameau näher zu bringen. In Mannheim pflegte Wolfgang Amadé freundschaftlichen Umgang mit einigen Freimaurern, vor allem Schriftstellern, Musikern und dem angehenden Intendanten des Mannheimer Nationaltheaters Dalberg. Während seines Paris-Aufenthalts 1778 wohnte er drei Monate bei Melchior Grimm, der als notorischer Atheist galt und dem inneren Zirkel der Enzyklopädisten angehörte; er lernte auch Grimms Geliebte Louise d’Épinay kennen und schätzen, die einen Salon führte, den schon Diderot, Rousseau, Voltaire und Montesquieu besucht hatten. 1784 fand er Aufnahme in die Loge «Zur Wohltätigkeit», zählte somit fortan zur politisch-intellektuellen Avantgarde Wiens, von Joseph II. begünstigt und beschützt. Mozarts Beziehungen zu dem Habsburger Reformkaiser sind hinlänglich bekannt. Doch was bekannt ist, ist noch lange nicht verstanden. Erst der von Herbig geschaffene Kontext ermöglicht es, Mozarts Schaffen aus seinem synkretistischen Weltbild zu erklären. Und damit endgültig jenes populäre Bild zu zerstören, das nicht erst Formans idiotischer «Amadeus»-Film gezeichnet hat, sondern von ganzen Generationen bornierter Pseudo-Forscher tradiert wurde und von heutigen Spaß-Regisseuren noch immer verbreitet wird.
Herbig beginnt damit, dass er Mozart beim Wort nimmt. Zwei Sätze aus den Briefen dienen ihm als Ariadnefaden durch den labyrinthischen Kosmos des «Don Giovanni». Der Komponist pocht darauf, mittels Musik seine «gesinnungen und gedancken» mitzuteilen, und er fordert von der Oper, die Welt in einer Weise darzustellen «als sey es wirklich so». Mit der einfältigen Ästhetik des Nur-Schönen hat Mozarts dramatische Kunst nicht mehr das Geringste zu tun. Fast jede Arie und jedes Rezitativ, oft einzelne Takte, ja einzelne Intervalle, Figurationen und rhythmische Feinheiten sind musikalische Symbole von Sprechhandlungen, wobei Mozart den Sinngehalt des Textes neu zu deuten und kompositorisch zu vertiefen unternimmt – getreu seiner Maxime, dass «bey einer opera schlechterdings die Poesie der Musick gehorsame Tochter seyn» müsse. Faszinierende Exkurse erläutern die semantische Funktion von Menuett und Musette und Pastorale, Tarantella und Siciliano.
Es gibt jede Menge verblüffender Fragen und Antworten. Warum hat die bürgerliche Aufführungsgeschichte gerade Donna Elviras Arie «Ah, fuggi il traditor» bagatellisiert oder noch lieber getilgt? Wie kann eine vermeintliche Rachearie, Donna Annas «Or sai chi l’onore», die kriegerischen Instrumente Flöte und Trompete ignorieren und im ruhigen Andante-Metrum verweilen? Und wie ist es zu erklären, dass Don Giovannis «Fin ch’han dal vino» unter dem Titel Champagner-Arie zu Weltruhm kam, obwohl Mozarts Manuskript dieses Getränk gar nicht erwähnt?
Herbig sorgt für eine psychologisch vertiefte Neubewertung fast aller Personen. Donna Anna, Donna Elvira und Zerlina werden von konventionellen Klischees befreit. Sie sind keine statischen Figuren, sondern wandlungsfähige Menschen, die es lernen, ihre erotischen Bedürfnisse jenseits normierter Geschlechterrollen zu definieren. Gerade hier haben Texte reaktionärer Romantiker, insbesondere Hoffmanns und Kierkegaards, fatale Folgen gezeitigt, weil sie Frauen zu defizitären Wesen erklären und in hierarchische Gesellschaftsverhältnisse zurückstoßen. Don Giovanni dagegen wird in ihrer Lesart zum dämonischen Genie und ungebundenen Freiheitsheros überhöht – was die Aufführungspraxis bis hin zu Walter Felsenstein entscheidend deformierte. Partitur und Libretto zeichnen ein ganz anders Bild.
Die Einbindung des Individuums in psychosoziale Prozesse wird im Falle Don Giovannis sogar besonders deutlich. Er ist im ersten Akt ein neurotischer Womanizer, ein typischer Adliger des Ancien regime, der die faktische politische Kastrierung durch Louis XIV. mittels inflationärer liaisons dangereuses zu kompensieren sucht; nach der Katastrophe am Ende des Akts, seiner Enttarnung beim Festmahl, kann er jedoch diesen Nimbus nur noch behaupten, nicht mehr beglaubigen. Mozart reflektiert auch dramaturgisch das in die Brüche gegangene Selbstbild Don Giovannis, den entropischen Prozess innerhalb der Aristokratie am Vorabend der Revolution, indem er die aristotelische Poetik und damit die Modelle des klassizistischen französischen Theaters für obsolet erklärt; er bedient sich stattdessen im zweiten Akt einer Form, die immer wieder als patchwork diffamiert wurde, tatsächlich aber die Konsequenz zieht aus der Entdeckung Shakespeares und eine Welt gewaltigster Konflikte schildert, die unteilbare Dialektik des Komischen und Tragischen beschwört, zuletzt aber, in der Sterbeszene Don Giovannis, die harsche Oberflächenrealistik transzendiert. Denn der vermeintliche Bösewicht fährt keineswegs zur Hölle, er versenkt sich freiwillig in einen Schacht und bleibt darin stecken. Welche Bedeutung der Komponist diesem Ort zumaß, beweisen seine nicht mehr zur Ausführung gelangten Pläne, eine Geheimloge mit dem Namen «grotta» zu gründen. Die Szenenanweisung «si (s)profonda» hat er eigenhändig um «resta inghottito» ergänzt, aber in der Neuen Mozart-Ausgabe fehlt dieser Zusatz. Dass es hier um eine Wiedergeburt geht, blieb der Rezeption auch deswegen verborgen, weil das Muster dieser Metamorphose der drakonische freimaurerische Initiationsritus gewesen ist, der wie die gesamte Glaubenslehre der Illuminaten grundsätzlich für irrelevante Schwärmerei gehalten wurde.
Die Szenenanweisung und der abrupte harmonische Umschlag nach D-Dur bilden ein performatives Momentum, das schockartig den Mysterienkult der Freimaurer vergegenwärtigt. Diese assoziierten zu dem griechischen Buchstaben «Δ» die Dreieinigkeit aus Weltall, Gott und Mensch, die Griechen sahen im Delta ein Symbol der Göttin Demeter wie auch der Vulva. Don Giovanni erleidet demnach nicht die von Augustinus ersonnenen Höllenstrafen, sondern erlebt das Sterben als umgekehrten Geburtsvorgang. Gott ist als absolute Richterinstanz entmachtet, und zwar auf denkbar humane Weise. Die absolute Negation des Lebens wird im letzten Akt des Lebens aufgehoben – so die Quintessenz des bedeutendsten Buches über das großartigste und tiefgründigste Werk der Operngeschichte.
(Volker Tarnow, Rezension in der Opernwelt Ausgabe Februar 2025, S. 66 f.)
https://www.der-theaterverlag.de/opernwelt/aktuelles-heft/artikel/ein-opfer-reaktionaerer-romantik/
