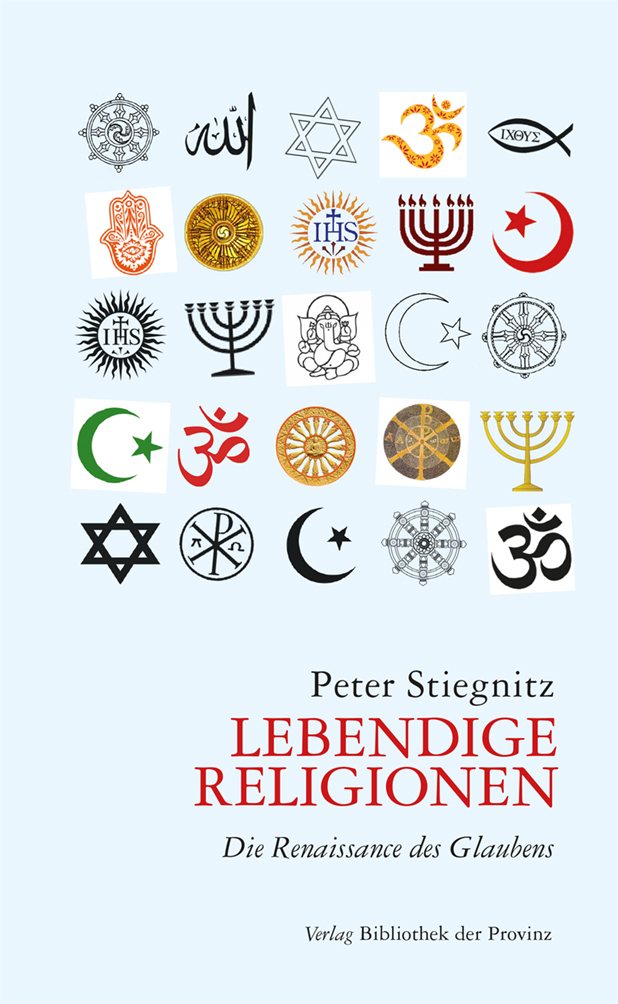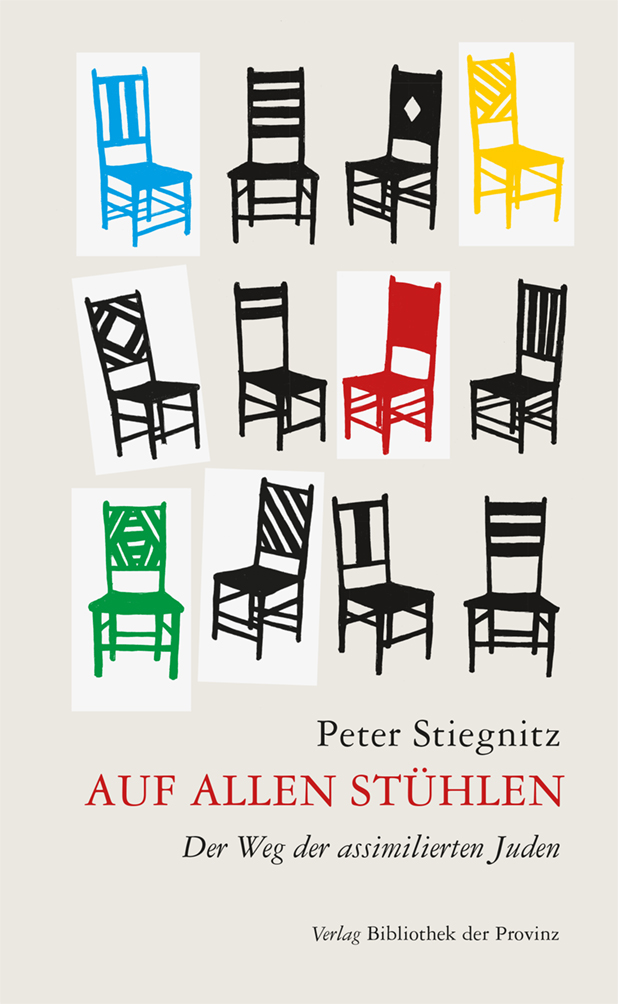
Auf allen Stühlen
Der Weg der assimilierten Juden
Peter Stiegnitz
ISBN: 978-3-99028-223-6
19,5×12 cm, 228 Seiten, Hardcover
18,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
Peter Stiegnitz zeigt den historisch wie politisch vorgegebenen Weg der assimilierten Juden auf. Seine eigene Familiengeschichte spiegelt diesen dornigen Weg wider.
Der Titel des Buches sowie ein eigenes Kapitel („Die Gewinner auf der Verliererstraße“) weisen auf den Widerspruch zwischen der guten gesellschaftlichen Position und der häufig geäußerten Unzufriedenheit seiner Schicksalsgenossen in Österreich und Deutschland hin, die angeblich immer „zwischen allen Stühlen“ sitzen; Stiegnitz hingegen sitzt stets „auf allen Stühlen“.
Es wird sowohl der Frage nach der „Heimat“ der Juden („Aus der Heimat vertrieben – in die Fremde heimgekehrt“) nachgegangen, als auch die Höhen und Tiefen bekannter assimilierter Juden („In Fromms Fußstapfen“) wiedergegeben sind.
Rezensionen
Alexander Emanuely: Der Meister vom StuhlDie Frage nach der eigenen Identität – das „Wer bin ich, woher komme ich und wohin gehe ich?“ – scheint so manche zu beschäftigen. Aus den Antworten erhofft man sich eine Medizin gegen Angst, Lüge, Einsamkeit, Orientierungslosigkeit, Ohnmacht und sonstige Probleme des Lebens mixen zu können. Nun kann es zwei Arten der Antwortsuche geben: die Analyse und das Konstruieren. Beim Analysieren geht es darum, Sinn und Funktion seines Umfelds zu erfassen. Beim Konstruieren eignet man sich mehr oder minder jene vorhandenen kollektiven Mythen an, die einem den Alltag zu erleichtern scheinen.
Peter Stiegnitz macht in seinem Buch „Auf allen Stühlen. Der Weg der assimilierten Juden“ beides und noch mehr, denn er dekonstruiert auch die Identitätssuche, stellt all das in Frage, was diese ausmacht, wobei das Sitzen auf allen Stühlen Symbol für seine Herangehensweise, für seine gelebte Kritik ist.
Peter Stiegnitz sitzt und saß nicht nur auf allen Stühlen, wie er schreibt, sondern fordert mit seinem Buch auch auf, sich zwecks Austauschs mit ihm zumindest einmal auf zwei Stühle zu setzen. Und auf dem Tisch, der sich bei diesem virtuellen Beisammensitzen zwischen Autor und LeserIn bildet, breitet er – derselbe, der die Wissenschaft der Lüge, die Mentiologie, begründet hat – mit humorvoller Ehrlichkeit und Intimität seine Lebens- und Ideengeschichte auf.
Peter Stiegnitz stellt teils autobiografisch, teils essayistisch politisch, historisch, soziologisch, psychologisch – kurzum interdisziplinär – untermauerte, provozierende Thesen zu Judentum, Assimilation, Antisemitismus, Philosemitismus auf, nicht um der Provokation Willen, sondern um ein konstruktives Streitgespräch zu ermöglichen. Und um seine Thesen zu illustrieren, zitiert er von Maimonides bis zur Science-Fiction-Serie „Star Trek“ quer durch die Wissensbank.
Als „realistischer Traumtänzer“ und gewollter Selbstdarsteller konfrontiert er die LeserInnen jedoch vor allem mit jenen 78 Jahren, die er als Jude überlebt, als Ungar überstanden hat und als Österreicher, ehemaliger hoher Staatsbeamter, Autor von 30 Büchern, 6.600 Fachbeiträgen und Vorstandsmitglied von 24 Vereinen nicht aufgehört hat zu erleben. Dabei erwähnt er im Besonderen einen Verein, dem er seit über vierzig Jahren angehört, und dessen philosophische Methode der Selbstfindung ihm massgeblich bei seiner Suche nach Antworten hilft, nämlich jenen der Freimaurer. Dabei ist zu erwähnen, dass man als Vorsitzender einer Loge den Titel „Meister vom Stuhl“ trägt und als solcher ruhig auch einmal ein paar Weisheiten von sich geben darf, ein Handeln, das Peter Stiegnitz auch als Autor nicht unterlässt.
(Alexander Emanuely, Rezension in: David. Jüdische Kulturzeitschrift Nr. 101/2014)
https://davidkultur.at/buchrezensionen/der-meister-vom-stuhl
Ferenc Nagy: [Rezension]
Auf Grund obiger Angaben würden wir eine österreichisch-deutsche Publikation vermuten. Doch dahinter steht das wechselvolle Schicksal eines 56-er Flüchtlings. Peter Stiegnitz, der Sohn evangelisch getaufter israelischer Eltern kam nach der Revolution nach Wien. Diese Religionsproblematik ist der rote Faden, den man verfolgen kann.
Der andere Faden (so etwas gibt es auch!) ist das Schicksal des mitteleuropäischen Judentums, dessen Mitglieder, bedingt durch ihr wechselvolles Leben stets zwischen allen Stühlen saßen. Der Autor hat als Zehnjähriger beschlossen, diesem Schicksal nicht zu folgen; lieber setzt er sich auf die Stühle, statt herunter zu fallen.
Dazu half ihm sehr, dass seine Eltern ihn evangelisch taufen ließen. So fiel ihm die Assimilation leichter. Weil diese das Überleben sichern. Stiegnitz lebt, mit augenscheinlicher Freude auch mit Widersprüchen. „Aus der Heimat vertrieben, in die Ferne heimgekehrt.“, oder „Die Gewinner unter den Verlierern“.
Die Ursachen des Antisemitismus analysierend liefert er originelle Erklärungen: „Die Juden schenkten der Menschheit den moralisierenden und strengen Gott; kein Wunder, dass man uns nicht liebt.“
Der Autor erwartet von seinen Lesern, dass sie die letzten 70 Jahre der mitteleuropäischen Geschichte kennen, da er oft auf Persönlichkeiten und Ereignisse dieser Zeit verweist. Doch eine allgemeine Bildung und Matura-Niveau schaden den Lesern auch nicht.
Wenn der geneigte Leser diese Kriterien mitbringt, dann wird er dieses Buch genießen, da es lesbar mit einem philosophischen jüdischen Humor geschrieben wurde. Der Leser bekommt in seine Hand einen Lebensroman, wobei unsere Generation dabei mit einem „Déjá-vu“ und einem „Aha“-Erlebnis konfrontiert wird.
(Ferenc Nagy, Rezension im Wiener Tagebuch [#?], 2014)
Peter Stiegnitz: Das Dilemma der assimilierten Juden
Eine soziologische Analyse der Juden ohne Religion
Die Stärke der Juden liegt in ihrer Schwäche. Zumindest was die Schwäche der Menge betrifft. Auf der ganzen Welt leben nach offiziellen Statistiken rund 13,2 Millionen Juden; davon knapp 5 Millionen in Israel und über 8 Millionen in der Diaspora; vorwiegend in Nordamerika und im europäischen Osten. In Wien leben ca. 14.000 Juden, davon sind nur die Hälfte Mitglieder der Kultusgemeinde. In Deutschland beträgt die Zahl der Juden rund 100.000.
Im Gegensatz zu diesem geringen Anteil der Juden in Österreich und in der Welt scheint ihre Bedeutung groß zu sein. Das vor allem im Spiegel des Antisemitismus, aber auch – wenn auch bedeutend minimaler – in philosemitischen Kreisen. Dass rechtsgerichtete Medien, vor allem in den ehemaligen kommunistischen Ländern, ständig von der „zunehmenden Gefahr des internationalen Judentums“ faseln, ist bekannt und nicht mehr nennenswert. Leider lassen auch linke und liberale Medien keine Gelegenheit aus, um – völlig unsicherer Weise – von „jüdischen Künstlern“ oder von „jüdischen Wissenschaftlern“ zu berichten.
Die so genannte „jüdische Szene“ – und dazu zähle ich jetzt alle religiösen oder nicht-religiösen Juden, die sich dazu bekennen – teilt sich vor allem in Österreich und in Deutschland in drei Kategorien:
· Die „Richter“ unter den Diasporajuden nehmen sich das Recht, „im Namen der Opfer“ des Holocaust über Antisemitismus-Ja oder Antisemitismus-Nein zu urteilen, wobei der Freispruch des „Nein“ Seltenheitswert besitzt.
· Die „Rächer“ bilden sich ein, die „Exekutivorgane“ der „Richter“ zu sein; sie lieben die Tat und verabscheuen die Analyse der jeweiligen Situation, die unter Umständen auch zu anderen Schlüssen als denen der „Richter“ führen könnte. Sie wollen es auch nicht verstehen, dass 1933 in Deutschland und 1938 in Österreich die Menschen anders denken und handeln mussten, als man es heute von ihnen verlangt.
· Die wohl undankbarste Rolle unter den Diasporajuden haben die so genannten „Renegaten“ übernommen. Ohne die Taten der NS-Mörder und ihrer Helfershelfer zu entschuldigen, bemühen sich die „Renegaten“ um ein historisches Verständnis. Ihre Aufgabe ist keineswegs das Verzeihen, sondern das Verständnis. Sie sind die eigentlichen Träger der Idee von Franz Vranitzky, der als erster Regierungschef von Schuld und Verantwortung der Österreicher in der NS-Mordmaschinerie sprach, aber auch jedwede Kollektivschuld verurteilte.
Diese „Renegaten“ bilden – auch hier wartet auf sie eine undankbare Rolle – die Untergruppe der assimilierten Juden, die ihr „Judentum“ nicht religiös bindet, sondern die sich als Angehörige einer überwiegend negativ determinierten „Schicksalsgemeinschaft“ betrachten.
Dabei taucht die wohl wichtigste Frage auf: Welche hauptsächlichen Kriterien bestimmen den gar nicht so kleinen Kreis assimilierter Juden? Ich bemühe mich, die wichtigsten dieser Bestimmungsfaktoren aufzuzählen:
· Primär ist wohl die Abstammung – die jüdische Mutter
· Die objektive Beteiligung an der Beschäftigung mit Gesetz und Geschichte der Juden
· Die Verneinung der jüdischen religiösen Gebräuche
· Bereitschaft und Vollzug einer christlichen Taufe und die damit verbundene Erfindung – als Ausrede – einer Sonderstellung an der Quelle des späteren Christentums. Dazu gehören weniger die so genannten „christlichen Juden“ als vielmehr die „Jesuaner“, die Anhänger des Rabbi Joschua und nicht des auferstandenen Christus
· Die selektive Betroffenheit des Antisemitismus; das heißt die Unterscheidung zwischen dem echten und dem vermeintlichen Judenhass. Nicht hinter jedem Volant eines Autobusses, der vor meine Nase wegfährt, sitzt ein Antisemit
· Offene Hinwendung zu anderen Religionen, Weltanschauungen und philosophischen Strömungen
· Bevorzugung von „Mischehen“
· Objektive Analyse zeitgeschichtlicher Ereignisse und Phänomene
· Identifikationsstörungen und die dadurch verursachte hochgradige Unsicherheit
· Anwendung traditioneller jüdischer Werte und Gepflogenheiten für intellektuelle und künstlerische Aktivitäten. Allerdings gehört die Buchorientierung frommer Juden genauso hierher wie ihr Bilderverbot.
Da Zukunft Herkunft braucht, haben die assimilierten Juden immer nur eine Gegenwart.
Obwohl die „Renegaten“ unter den assimilierten Juden kein Produkt der Nach-Holocaust- und Kriegszeit sind, leben sie heute wie vor der NS-Barbarei in ihrer jeweiligen Gegenwart; sie besitzen nicht einmal eine lose historische Kontinuität. So manche unter ihnen, eingebettet in die damalige obere Gesellschaftsschicht des wohlhabenden Mittelstandes, unterlagen sogar der „Faszination des Faschismus“; so auch die sichtbare Ordnungsmanie des italienischen Faschismus. Auch die Angst der jüdischen Großbürger in Spanien vor dem Kommunismus zog Francos Kampf gegen die vereinigten Linken des Landes magnetartig die Sympathie dieser Juden an. Die assimilierten Diasporajuden litten immer schon unter ihrer stark ausgeprägten Harmonie- und Anpassungssucht.
Jeder Mensch hat eine Heimat. Wirklich? Die Assimilierten, deren nirgends fache Zugehörigkeit wohl am Jüdischesten ist, haben keine Heimat. Eine geographische Heimat hat genau genommen seit Auschwitz kein europäischer Jude mehr, wenn ich von einigen Wiener, Budapester und Berliner Kaffeehäusern absehe. Die gläubigen Juden haben ihre Ersatzheimat in der Religion, die „Richter“ in ihrer Urteilssucht, die „Rächer“ in ihrer Kampfesfreude. Nur der assimilierte „Renegat“ besitzt keine Heimat; auch keine Ersatzheimat. Er ist nämlich immer und überall ein Fremder. Vor allem die extremsten Assimilierten, also die christlich getauften, leiden am meisten unter ihrem Identitätsmangel. Für die Juden, die sich zu ihrer Religion bekennen sind sie die „Renegaten“ und für ihre neue Kirche „religiöse Zugereiste“.
Des Hebräischen nicht mächtig, ohne eine inneren, religiösen Bindung und Bejahung der Feiertage oder zumindest der wichtigsten Gesetze wird aus einem assimilierten Juden kein wirklicher Jude. Der einzige wirkliche „Helfershelfer“ assimilierter Juden ist der Antisemitismus. Aus diesen feindseligen Bausteinen der Judenablehnung versuchen die Assimilierten verzweifelt ihre „jüdische Identität“ aufzubauen. – Etwas Kläglicheres gibt es wohl kaum!
Also: Assimilierte Juden sollten den Antisemitismus nicht verachten. Ich meine natürlich nur den „friedlichen“, nicht Judenmord und Judenraub, nicht die Numerus-clausus-Verbotstafeln an den Universitäten, sondern schlicht und einfach das Schmiermittel für den Motor der Assimilierten, der jedweden Austritt aus dem „Judentum“, aus dieser Schicksalsgemeinschaft unmöglich macht.
Jetzt auch noch etwas Positives: Wer schreibt, der liest auch – und tunlichst nicht nur das Eigene – und wer liest, der macht sich Gedanken. Wer sich Gedanken macht, der kommentiert. Und so entstand aus der Thora der Talmud und aus dem Talmud die unendlich vielen weiteren Auslegungen und verfeinerten und vertiefenden Kommentare wissender Rabbiner.
Auch assimilierte Juden leben, schreiben, denken und lernen nach diesem religiösen Gebot. Seit sie selber den Glauben ihrer Väter mehr oder weniger freiwillig verlassen haben, wandern sie unstet im intellektuellen Exil herum.
Juden und Wiener passen in der gemeinsamen Ermangelung echter Identitäten zueinander. Dazu ein Zitat: „Wir (Juden und Österreicher) hatten Identitätsprobleme. Ich, der ich aus einem fragmentarischen Österreicher einen ganzen Juden machen musste – und das kleine, arme Übrigbleibsel des Habsburgerreiches, das nicht wusste, was es aus sich machen sollte“ – formulierte diese negative Gemeinsamkeit der aus Wien 1938 emigrierte US-Rabbiner Joshua O. Haberman.
Am Anfang jeder psychischen Verkrampfung stehen Identitätsschwierigkeiten. Erlebte und erfahrene Begriffe wie „Heimat“, „Zugehörigkeit“, „Vaterland“, „Muttersprache“ und Ähnliches mehr gewähren jedem Menschen das sichere Gefühl, in einer kulturellen „Eigentumswohnung“ zu leben und nicht als „Untermieter“ vegetieren zu müssen.
Diese Psycho-Verkrampfung allein genügt vielen in Österreich lebenden Diasporajuden nicht. Sie suchen, vor allem die bereits erwähnten „Rächer“ und „Richter“, um ihre innere Zerrissenheit auch künstlich am Leben zu erhalten, nach immer neuen Beweisen der „Naziverseuchung“ Österreichs. Dazu gehört z.B. die nur zum Teil richtige Behauptung, dass in österreichischen Schulen „kein zeitgeschichtlicher Unterricht“ erfolgte, weil – zumindest nach der Befreiung – ein Gutteil der Nachkriegslehrer allesamt „verkappte Nazis“ waren.
Dass diese Behauptung nicht immer stimmt, beweist der aus Wien 1938 emigrierte Gründer und Direktor des Instituts für deutsche Geschichte an der Universität Tel Aviv, Walter Grab: „In der Schule gab es keine Antisemiten. Die Gymnasiallehrer waren entweder Sozialdemokraten oder Altliberale, die im Geist des toleranten Vielvölkerstaates aufgewachsen waren; der Primus unserer Klasse war der Sohn des Rabbiners des Müllner-Tempels am Alsergrund.“
Natürlich ist Antisemitismus in Wien in Geschichte und Gegenwart kein unbekanntes Phänomen. Schon aus diesem Grund, und erst recht um die geraubten Güter nicht rückerstatten zu müssen, waren die reemigrierten österreichischen Juden nach dem Zweiten Weltkrieg in der „alten Heimat“ alles andere als willkommen.
Die meisten sozialpsychologischen Begriffe, vor allem „Selbstbewusstsein“ und „Identifikation“, stehen oft auf tönernen Füßen. Erst recht im Leben der assimilierten Juden, deren Familien sich bereits in zweiter und dritter Generation von der jüdischen Religion entfernt haben.
Genauso labil wie der Bezug zur Religion sind die zionistischen „Wurzeln“ der assimilierten Juden. Abgesehen vom guten Gefühl, ein Land zu haben, das jeden vor dem Antisemitismus flüchtenden Juden aufnehmen muss, kann eine wirklich innere Bindung zum Land Israel, das vielleicht vor 2000 Jahren die „uralte Heimat“ war, nicht geknüpft werden.
Religion ohne religiöse Tradition, Zionismus ohne wirkliches Heimatgefühl sind weitere und entscheidende Elemente, aus denen viele assimilierte Juden in der Diaspora ihr widersprüchliches Leben diktiert bekommen.
(Peter Stiegnitz, Rezension für: haGalil.com. Jüdisches Leben online, veröffentlicht am 6. Juli 2015)
https://www.hagalil.com/2015/07/assimilierte-juden/