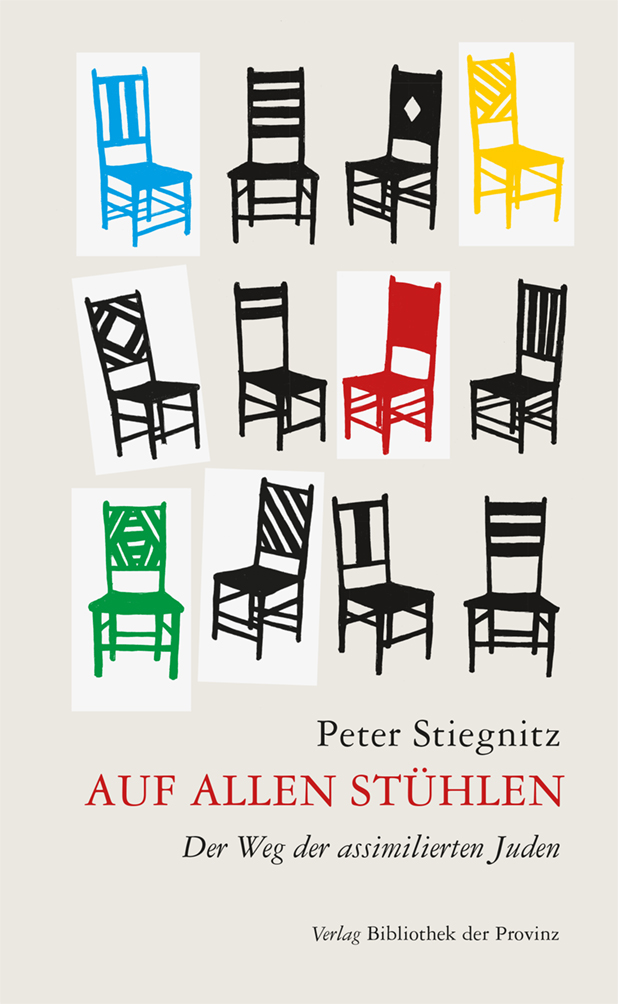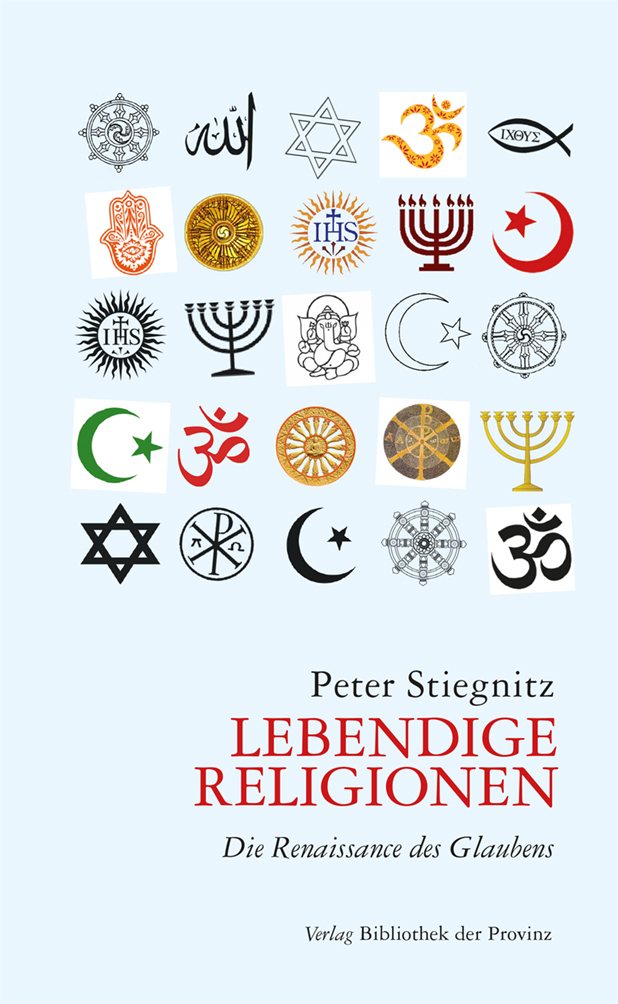
Lebendige Religionen
Die Renaissance des Glaubens
Peter Stiegnitz
ISBN: 978-3-99028-481-0
19,5×12 cm, 292 Seiten, Hardcover
20,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
Religionen sind selten sympathisch; vor allem nicht die der anderen. Auch die eigene Religion kennen viele Menschen kaum. Und das ist schade, weil die Weltpolitik heute ohne das Thema „Religion“ nicht mehr existieren kann.
Das grundlegende Missverständnis, warum die Religionen oberflächlich-negativ beurteilt werden, liegt in der unzulässigen Vermengung von Glauben, Religion und Konfession:
· Unter Glauben verstehen wir eine feste Überzeugung jenseits empirischer Wahrnehmungen.
· Die Religion bietet einen individuell vorgezeichneten Rahmen, der nicht von außen gelenkt wird.
· Die Konfessionen sind politisch-theologisch festgelegte kollektive Aussagen.
Wir müssen uns auch im „Wohlstands-Europa“ mit den Fragen der Religionen beschäftigen; dabei entdecken wir die „Zeichen der Zeit“. Genau diese Renaissance des Glaubens erleben wir heute als die lebendigen Religionen.
Rezensionen
Peter Stiegnitz: Religionen verbindenDemoskopen wissen es besser: Österreich würde ohne Zuwanderung langsam aussterben. Natürlich ist eine kontrollierte Zuwanderung für die Wirtschaft, vor allem für die soziale Sicherheit besser als eine unkontrollierte. Doch seit die Genfer Flüchtlingskonvention auf UNHCR-Einfluss auch die Kriegsflüchtlinge in ihren Katalog aufnahm, was ursprünglich (1951) nicht der Fall war, kann die Migration, wie einst die Gastarbeiter Anfang der 60-er Jahre, nicht mehr bedarfsorientiert erfolgen.
Tatsache ist, dass durch die Migrationsströme vorigen Jahres der muslimische Anteil an der Bevölkerung stark zugenommen hat. Damit müssen wir rechnen. Leider auch mit der Präsenz des islamistischen Einflusses in Kindergärten, Schulen und in nicht wenigen Moscheevereinen.
Das Zauberwort, das die Politik, die Medien und vor allem die sozialen Netzwerke immer wieder verwenden, heißt „Integration“. Ein Wort, das man leichter ausspricht als dessen Inhalt verwirklicht. Bereits die deutsche Übersetzung ist nicht nur zwei-, sondern sogar mehrschneidig: „Einbindung in ein Ganzes“. So gesehen ist die Integration keine Einbahnstraße; auf die Integrationsbereitschaft seitens der Migranten sollte eineS ihnen angebotene Integrationsmöglichkeit folgen. Und das ist alles andere als leicht. Soziologische Erfahrungswerte, fernab von ethischen Forderungen, kennen die beiden größten Integrationshemmfaktoren: die Religion und die Familienzusammenführung. Die jüdischen und christlichen Migranten seit Ende des Zweiten Weltkriegs waren bereits in der ersten und spätestens in der zweiten Generation, vor allem wenn sie in sprachlichen „Mischfamilien„ lebten, „vollintegriert“. Und das unabhängig von ihrer sozialen Stellung.
Gänzlich anders – und das ist kein Geheimnis – ist die Situation in den türkischen (ehemaligen) Gastarbeiterfamilien, wo „Mischehen“ vor allem aus religiösen Gründen nicht möglich waren. Diese sozio-kulturelle Gegebenheit wird durch die muslimischen Flüchtlingsströme seit 2005 immer stärker. Noch dazu sind rund 80 Prozent der Flüchtlinge junge, alleinstehende Männer.
Die dadurch auftretenden Probleme kennen wir. Diese zu verbreiten ist nicht schwer, doch Rezepte zu finden, die sich nicht mit der Wiederholung von Allgemeinplätzen begnügen, auch wenn diese gutgemeint aus der Schatzkiste der Ethik entnommen werden, ist außerordentlich kompliziert. Probieren wir es trotzdem.
Die drei monotheistischen Religionen – Judentum, Christentum und Islam – haben der Legende nach nicht nur einen Stammvater Abraham/Ibrahim, sondern auch gemeinsame, vorwiegend soziale Wurzeln; so zum Beispiel die Hilfe und die Mildtätigkeit. Alle drei Heiligen Schriften erinnern uns an die Pflicht der tätigen Nächstenliebe. So setzte sich auch Mohammed für die Witwen und Waisen ein, denen in den polytheistischen Stammreligionen in Arabien nur mit Verachtung begegnet wurde. Vergessen wir nicht auf Mohammeds Weisung, Juden und Christen, da auch sie Vertreter von Buchreligionen sind, keineswegs als „Ungläubige“ anzusehen und zu bekämpfen.
Wer bereit ist, sich auf die Suche nach den vielen Gemeinsamkeiten dieser Religionen zu machen, der findet nicht nur die durchaus ähnlichen Speisevorschriften der beiden „Wüstenreligionen“ Judentum und Islam, sondern zahlreiche andere auch.
Für die Wohlstandsbürger in Europa, welche die Religion zur Privatsphäre degradierten, ist es nicht leicht zu verstehen, dass für die zugewanderten Muslime ihr Glaube eine zentrale Rolle spielt. Genau deshalb, um einen sinnlosen „Kampf der Kulturen“ zu vermeiden, ist es unerlässlich notwendig, die Gemeinsamkeit der Religionen zu finden und nicht das Trennende zu suchen.
(Gastkommentar von Peter Stiegnitz in der Wiener Zeitung vom 25. Mai 2016)
https://www.tagblatt-wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/820403-Religionen-verbinden.html