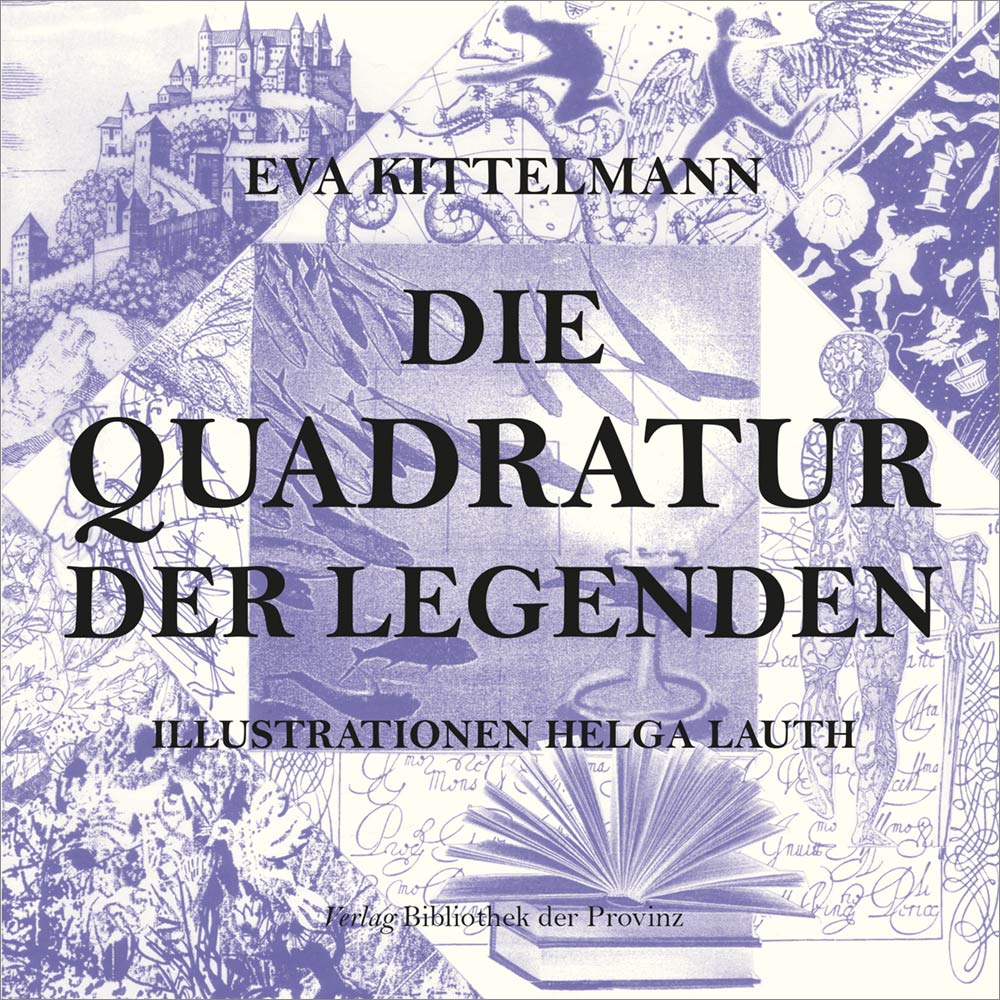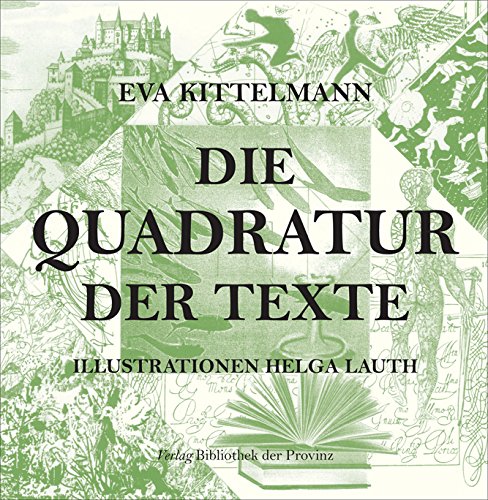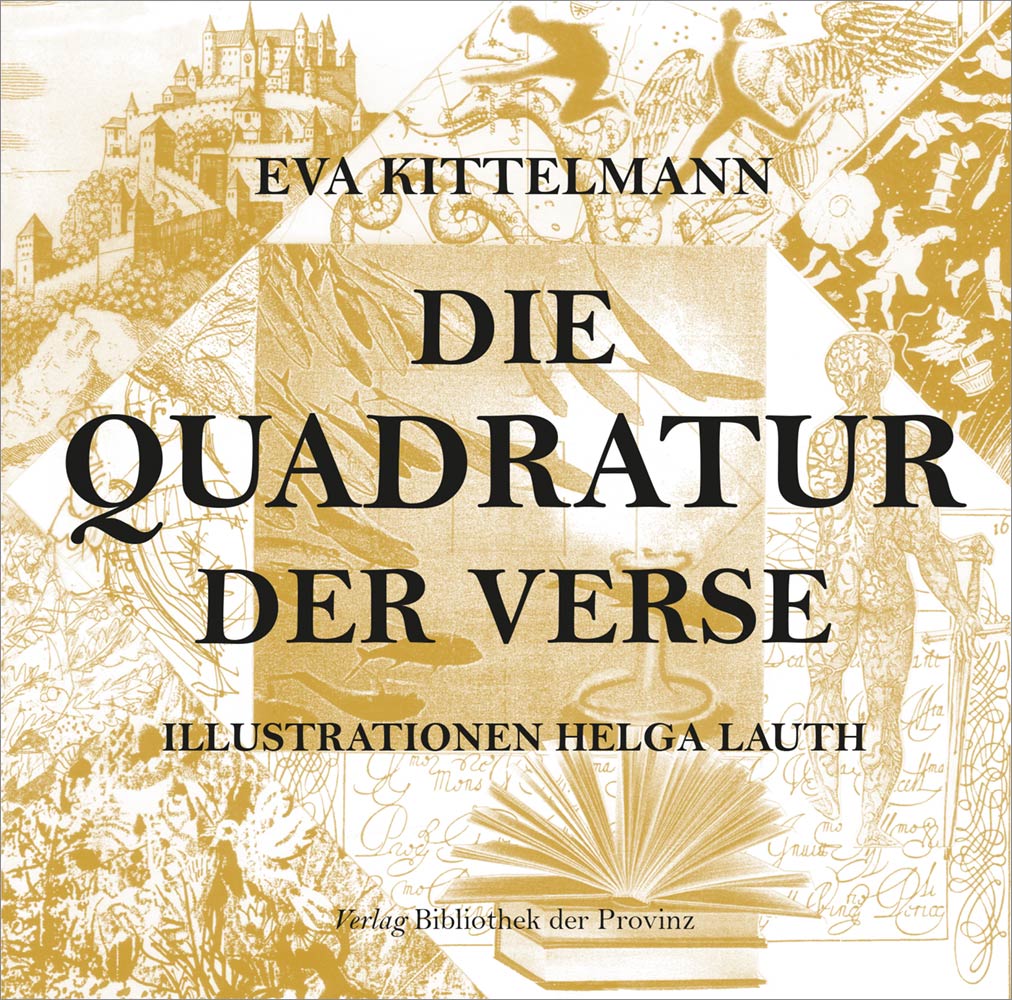
Die Quadratur der Verse
Eva Kittelmann, Helga Lauth
ISBN: 978-3-99028-164-2
15×15 cm, 128 Seiten, zahlr. Abb., Klappenbroschur
15,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
Gefühl wird Denken, Traum zu Text. Das Werk ist eine poetische Offenlegung und ein literarisches Vermächtnis in mehr als einhundert ausgewählten Sequenzen, die, ursprünglich im „Blindversuch“ geschrieben, typographisch zu „Quadraten“ ausgestaltet wurden. So entstand eine magische Verführung ins „Irgendland“ der Lyrikerin Eva KITTELMANN, dessen Erkundung Lesegenuss bereitet – durch hinreißende, sprachgewaltige Gebilde voll kühner Imagination und metaphorischem Reiz. Mit den kongenialen Collagen von Helga LAUTH, die ebenfalls Traumwelten eröffnen, erscheint die angestrebte „QUADRATUR DER VERSE“ gelungen.
Rezensionen
Rudolf Viktor Karl: [Rezension]So wie die Quadratur des Kreises ein Symbol für das Unlösbare darstellt, so geben die lithographischen Quadrate der Eva Kittelmann uns Prüfungen auf, die darin bestehen, den Wust aus Wortspielereien, Metaphern und Querverbindungen zu ergründen. Denn es gibt keinen roten Faden, keine Gliederung der Inhalte, keinen Ariadnefaden, um das Labyrinth zu durchforschen. Jeder muss für sich selbst einen Weg oder eine Einstellung zu diesem Sprachkunstwerk finden, denn es stehen – sehr verborgen und verschlüsselt – Lebensweisheiten in fast jedem Quadrat. Interessanterweise – aber doch nicht überraschend – kann man, durch Fußnoten belegt, ableiten, dass man aus der Geschichte nichts gelernt hat und im Traum Dinge geschehen, die man leugnen möchte und die doch Jahre später Wirklichkeit werden.
Essayartige Arabesken schlingen sich um Zitate berühmter Denker und Dichter, werden ad absurdum geführt und selbst Monate wie September, Oktober erscheinen in Kittelmanns Sicht und Sprache vollkommen neu und weit von den üblichen Aussagen entfernt. „Was man nicht sucht, gehört zu dem Verlorenen“; „Es gibt mehr als alles“; „Dichten ist dichteres Sagen als Lallen.“
Die hundert Quadrate belegen diese Aussage auf das Deutlichste. Man wird in den Bann gezogen, beginnt nachzudenken und schmunzelt vielleicht über manche sprachliche Formulierung oder Neubildung. Die Collagen von Helga Lauth entsprechen haarscharf der sprachlichen Vorgabe. Lesen Sie und versuchen Sie selbst, die Quadratur der Verse zu lösen.
(Rudolf Viktor Karl, Rezension in: Werte und Worte. Mitteilungen des Verbandes Geistig Schaffender und Österreichischer Autoren, Jänner 2013)
Cordula Scheel: [Rezension]
Diesmal ist alles anders. Ich möchte Sie einladen: Nähern wir uns der wohlbekannten Dichterin Eva Kittelmann als das unbefangene Kind, das wir einmal waren, fröhlich und neugierig. Nicht: Was will uns die Autorin sagen?, ist die Frage, sondern: Wollen wir zusammen spielen? Also, lassen Sie uns gemeinsam Freude haben an Versen und Reimen, die hin und wieder durchaus an „reim' dich oder ich fress' dich“ erinnern. An Texten, die unmäßig sein können, aber stets im Versmaß bleiben. Wir wollen sehen, wie viel Geheimnis, wie viel Tiefe der helle Unsinn in sich trägt. Nicht ohne Grund entstehen diese Quadrätchen, wie Eva Kittelmann sie liebevoll nennt, zu einer Lebenszeit, in der die Leichtigkeit des Seins vornehmlich aus Träumen herüberweht. Die Jahre drücken, doch wie viel heiteres, unsinniges, gewagtes, geliebtes Leben enthalten sie, wenn wir sie noch einmal träumen. Lassen wir uns mit einem Lachen ein auf die Quadratur der Verse, hin und wieder werden wir glauben, Eva Kittelmann kichern zu hören, wenn uns ein verdrehter Text verwirrt oder aufs Glatteis führt. Also, brechen wir auf zu einer intensiven Lektüre, so viel Respekt muss sein, wir haben es immerhin mit einer „femme de lettre“ zu tun.
Für dieses Buch haben sich eine Autorin und eine Illustratorin zusammengetan, die beide Meisterinnen ihres Fachs sind. Es verwundert nicht, dass ihr Buch „Die Quadratur der Verse“ außergewöhnlich geworden ist in Text und Gestaltung. Das versprechen schon die Bilder. Aus Buchseiten quellen griechische Helden, Tierkreiszeichen, ein Schloss mit Paradiesgärtlein, der Mensch als Lehrstück, archaische Formen, Grillen musizieren, auf wen wartet die Geige neben ihnen? Die Rückseite des Buches dominiert ein Frauengesicht, das einen offenen Engelflügel so verbirgt, dass er zu ihr gehören könnte (oder fliegt im Hintergrund eine Gans vorbei?). Welch eine Leseeinladung.
In „Genealogie“ hören wir auf S. 59 den Puppen zu. Sie kuscheln und flüstern, so schöne Troddeln an ihnen, „Amsel-Trottel, findst-du-gar?/Im Lehnstuhl, verdammich, ich schlafend.“ Aha, so geht das hier zu. Und auf der Seite zuvor ein Wort zum Reimen: „Wir sind so tüchtig, … Gerimt auf züchtig passt hier eher schlecht.“
Es kommt noch besser; s. 65: „Eden: Was kann denn Gott dafür, dass die perfide Schlange in Adams Garten kroch? Sie hätten sie ja feuern können, … den Teufelsbraten grillen, … hernach ein Apfelmüsli zum Dessert – Prometheus war doch längst erfunden? Ich weiß, ich spring im Traum durch die Jahrtausende. Es hört sich bloß so appetitlich an: At Eden's Evil-Devil-Grill we dined, a barbacue, indeed.“
Indeed, wer wollte jetzt nicht weiterlesen? Wenigstens ein kleines Stück noch? Also die S. 73: „Vollkommen: Vom Einfall der Minute leb', von Miniträumen, Gesichten hinter fremden Augen, von scheinbar wandelnden Gestalten, von Urgewalten wie du selbst sie bist.“
Träume, Gedankenfetzen aus dem Unbewussten nehmen Gestalt an, Vorahnungen „märchenhafte Elemente kommen ins Spiel“, schreibt Eva Kittelmann im Geleitwort. Die Quadratur gibt ihnen den Raum einer Fläche, die lange Zeilenführung macht uns bisweilen atemlos, verstärkt das Parlando. Texte nehmen uns gefangen, erinnern an Poetry-Slam. Die vorgegebenen Grenzen der Quadrate wirken sich positiv aus, sie lassen die Gedichte nicht ausufern, verstärken die Aussage. So erweist sich die ungewöhnliche Form des Buches als sinnvoll, sie ist keine überflüssige Spielerei. Eva Kittelmann hat es nicht nötig, „in“ zu sein, sie hält aber ebenso wenig fest an überlieferten Formen, wenn ein Experiment sie lockt.
Der Titel „Quadratur der Verse“ evoziert natürlich den Begriff „Die Quadratur des Kreises“, zur Metapher geworden für eine unlösbare Aufgabe, die seinerzeit mit den festgelegten Hilfsmitteln nicht zu bewältigen war. Eva Kittelmann unternimmt mit der Niederschrift ihrer „Quadratur der Verse“ ebenfalls den Versuch, innere und äußere Gegenstände in Einklang zu bringen. Sie aber ist frei in der Wahl ihrer Mittel, vorausgesetzt, sie ist „ausgestattet mit dem Kompass der Poesie“, von dem Czeslaw Milosz spricht, „der empfindsam ist, ausdauernd und nicht auf Zustimmung angwiesen“. Daran haben wir bei Eva Kittelmann keinen Zweifel. Sie unterwirft Ausschweifendes der Strenge, verschmilzt Licht und Schatten, nicht ohne Hell und Dunkel oft kräftig zu überzeichnen und den Leser zu strapazieren. Ihre Neugier auf Neues, die Sehnsucht nach unwiederholbar Vergangenem, Träume und Leben vermischen sich in ihren Versen zu einem Labyrinth, dessen Grundstimmung, anders als beim Irrgarten, das Vertrauen in die Geborgenheit seiner Mitte ausmacht. Trotzdem, die Grausamkeiten des Lebens lässt sie nicht aus.
Auf S. 83 schreibt sie: „Ranständig // Bin auf der Flucht. Waldschlünde springen mir entgegen, blauseidene Etablissements, … ein blinder Junge lag … den toten Hund in der verbrannten Hand …“ Farben tauchen auf, ihre archaische Symbolik spiegelt sich selbstverständlich in unseren Träumen. S. 119: „Finis Terrae // … Wie farblos alles wird! Vermisse ich das gelbe Sonnentuch, die Blaue Grotte, den Roten Fingerhut? Madonnenschwarz & Grüngewölb verschwunden. Die Welt liegt hinter mir wie lila Kleid & Fastenwoche. Jetzt in den Weißen Nächten.“ Häufig symbolisiert Blau im Zusammenhang mit dem Himmel Grenzenlosigkeit, Meerblau verdeutlicht die Erfahrungstiefe einer Verbundenheit. Auf S. 115 geht es um Indigo, um Transzendenz: „Kontinentalverschiebung // … Könnte, falls sie nicht tot wär', ich eru-& telefonieren, … Ich stellte die Frage in das nachtblaue Weltnetz …“ Dass auch der „Quadratur des Kreises“ ein transzendenter Aspekt innewohnt, wird Eva Kittelmann mit einem Lächeln quittieren.
Ihre Freude an Worten erheitert und ist gekonnt: So lässt sie „Schwellenangsthasen“ lebendig werden, „Obertonleitern, Wegekreuzrippen und Kugelblitzschreiber“ (S. 97) „nicht mit dem Verstand zu lesen“, oder „mir ist so mozärtlich nach Zauberflöte“ (S. 105) bis hin zum „doppelt gemoppelt“, das den Ernst des wunderbaren Gedichts „Bis“ relativiert, in dem sie davon spricht, wie tief uns Gedichte in den Traum hinein nachgehen (S. 120). Wenn letzte Dinge anstehen, beeindruckt diese Scheu vor „großen Worten“. Als wolle sie abwiegeln, wenn es um die Quintessenz ihres Lebens geht.
Noch einmal komme ich auf Czeslaw Milosz zurück. Er war der Überzeugung, dass Gedichte immer gegen den Tod geschrieben werden, mögen sie optimistisch oder pessimistisch sein.
Eva Kittelmanns Quadratur-Verse sind eher nicht freundliche Gute-Nacht-Geschichten, sondern machen einen Kosmos aus inneren Räumen transparent, zeigen die prägenden Koordinaten ihres Lebens. Beziehungsmuster werden noch einmal seismografisch erfahren. Der scheinbare Zufall kommt ins Spiel, das Erleben der Gleichzeitigkeit von Ereignissen, die Erfahrung: Alles ist unter einander verbunden.
Eva Kittelmann beantwortet damit das vorangestellte Motto von Marjan Tomic: „Was ist das Leben?“ Das gilt auch für unsere Sinnfrage zu Beginn dieser Betrachtung. Wie hoch der Preis ist, den sie ihrem Talent schuldet, können wir nur erahnen.
Wir haben uns eingelassen auf „Die Quadratur der Verse“ und erleben, auch wer sich selbst einlässt, kann gefangen bleiben. Wer davon zurückschreckt, wer den sogenannten festen Boden keinesfalls verlassen möchte, wer überdies auf ein schnelles Leseerlebnis aus ist, dem sei diese Lektüre nicht empfohlen.
Aber es gilt: Schon optisch ist „Die Quadratur der Verse“ mit den ebenbürtigen Illustrationen von Helga Lauth ein sehr schönes Buch geworden. Souverän geschrieben gibt es Einblick in die vielschichtige Persönlichkeit Eva Kittelmanns. Es ist ein lohnendes Abenteuer, sich der manchmal überbordenden Strömung dieser Verse anzuvertrauen.
(Cordula Scheel, Rezension in: Der literarische Zaunkönig. Die Zeitschrift der Erika Mitterer Gesellschaft, 1/2013, S. 60 f.)
Herbert Jan Janschka: [Rezension]
Natürlich erinnert der Titel des Buches auch den mathematisch Minderbegabten zuallererst an die Aufgabe der Quadratur des Kreises. Gefängnisaufenthalte können einem offenbar so sehr die Träume rauben, dass sie einen über alles Mögliche nachdenken lassen. So auch den wegen Gottlosigkeit inhaftierten griechischen Philosophen Anaxagoras, der die Nächte damit verbrachte, über die Quadratur des Kreises nachzudenken. Diese Überlegung führte zu einer Kettenreaktion von diesbezüglich wissbegierigen Philosophen und Mathematikern, bis endlich 2.300 Jahre später Ferdinand von Lindemann beweisen konnte, dass diese Aufgabe unlösbar ist. Seither, so heißt es, können Philosophen und Mathematiker endlich wieder besser schlafen.
Eva Kittelmann ihrerseits hat mit ihrem Buch bewiesen, dass sie Aufgabe der Quadratur der Verse literarisch lösbar ist. Nicht, um das gleich vorwegzunehmen, nicht die durchwachten Nächte in einem Gefängnis waren der Grund ihrer Versuche. Es gäbe auch keinen Anlass Eva Kittelmann wegzusperren, schon gar nicht den der Gottlosigkeit. Das würde auch nicht in den Lebenslauf der Generalsekretärin des Verbandes katholischer Schriftsteller hineinpassen. Es war die Dunkelheit der Nächte ihrer vier Wände, in denen die Ideen zu den Sequenzen dieses Buches das Licht ihres Daseins, das Licht ihres Werdens, das Licht ihrer Form erblickten. Ob sich die Menschheit nun auch zwei Jahrtausende lang mit der Quadratur der Verse beschäftigen wird, lässt sich wohl nicht mit Bestimmtheit voraussagen.
Während ich mich herzlich darüber ärgern kann, dass manche Schreibende glauben, ein senkrecht aufgegliederter Satz wäre bereits ein Gedicht, beweist uns Eva Kittelmann, dass sich die Poesie in die mathematische Enge eines Quadrates hineinschreiben lässt, dass die Melodie der Lyrik keine vorgegebene Form hat, außer die Souveränität der Sprache, vorausgesetzt sie wird beherrscht, so wie von ihr.
Über 100 Ideen, Gedankensplitter, Träume, Andeutungen nehmen in lyrischen Quadraten die Gestalten an, die aus dem Unbewussten hinübergeschrieben werden, in unsere Welt, in unser Verständnis, in unsere Augen, in unsere Herzen. Die einzelnen Sprachquadrate sind nicht in einer schwachen Stunde nacheinander durchzulesen. Der Leser wird sich Zeit nehmen müssen für dieses Buch. Jede einzelne Seite ist ein in sich geschlossenes Gedankenexperiment, von der Überschrift über das erste bis zum letzten Wort ein lyrisches Spiel, jedes Wort ein Schachzug, intuitiv und überlegt zugleich.
Lassen wir abschließend den Prolog dieses Buches zu Wort kommen und ihn als Epilog dieser Rezension genauso unantastbar stehen: „Diese Texte entstehen spontan aus Nachtträumen, Alb-, Halb-, Nach- und Tagträumen. Größtenteils wurden sie bei völliger Dunkelheit erst ‚blindlings‘ aufs Papier geworfen und haben in wunderbarer Weise auch bei Licht besehen in aller ‚Einfalt der Poesie‘ für sich bestande.“
(Herbert Jan Janschka, Rezension in: Literarisches Österreich #2013/1)
Elisabeth Schawerda: [Rezension]
Ein sorgfältig gestaltetes Buch, quadratisch, auf jeder Seite ein abgeschlossener Text in einem Quadrat. Die Sprache von einem pulsierenden Rhythmus getrieben, eine heftige, eilige Sprache. Mühelos scheint die Autorin ihr Unbewusstes mit ihrem glasklaren Verstand zu verkoppeln. Springt auch in verschiedenen Sprachen umher, da ja nicht in jeder Sprache, auch nicht der eigenen, der Punkt zu treffen ist, den sie treffen möchte. Aber nur für einen Moment. Schon geht es weiter. Wie ein Zaubergarten, dessen Labyrinthe nicht nur aus eintönigen Buchsbaum sondern aus vielen exotischen Gewächsen geformt sind, wie ein riesiges Märchenschloss, in dem man nie alle Zimmer kennen kann, so empfindet man dieses Buch. Man liest zuweilen verwirrt, oft amüsiert, betroffen und nachdenklich.
Eva Kittelmann schreibt aus den verschiedenen Stadien und Möglichkeiten der Träume. Sie lässt zu, was da kommt. Begrüßt es, umarmt es gleichsam mit Assoziationen aus ihrer umfangreichen Bildung. Diese und ihre Imaginationsgabe scheinen ihr stets präsent zur Verfügung zu stehen und zwar in solcher Fülle, dass sie sich Grenzen setzen muss. Sie steckt eine Umzäunung ab, ein Quadrat, und füllt es aus. Überquellend. Und keinem der Texte wird die Möglichkeit gegeben, dieses Maß zu übertreten.
Wenn es auch keine Gedichte sind, es sind lyrische Texte, verdichtet, geheimnisvoll, musikalisch, mit Sprachspielen und Worterfindungen. Oft wirken sie wie in Trance oder im Stadium zwischen Wachen und Schlafen geschrieben. Manchmal sind sie durch wie von selbst sich ergebende Reime ineinander verflochten, ein intensives Geflecht aus Gefühlen, Gedanken, Fantasien. Eruptionen von Leidenschaft und intellektueller Poesie. Geschrieben wie „ecriture automatique“. Unzensuriert in den Einfällen, aber gebändigt in der Form. Die Sogwirkung dieser Sequenzen lässt den Leser von Seite zu Seite blättern, um den Irrgarten zu durchstreifen. Die Freude der Autorin am Akt des Schreibens ist fühlbar.
Und ihre Themen setzen sich keine Grenzen, sie springen vom Naheliegenden zum Besonderen, von Land zu Land, durch Märchen und Mythen, ohne chronologische oder eine andere Ordnung des wachen Alltagsbewusstseins. Wie die Träume setzen sie sich aus sehr verschiedenen Elementen, aus allem, woran das Leben jemals streifte, zusammen und bilden ein dichtes Gefüge.
Ein sehr ungewöhnliches Buch. Helga Lauths Illustrationen sprechen ihre eigene Bildsprache, mit Symbolen und Metaphern, zuweilen unheimlich oder geheimnisvoll wie ein fremdes Märchen.
(Elisabeth Schawerda, Rezension in: Podium #169/170, 2013, S. 132 f.)