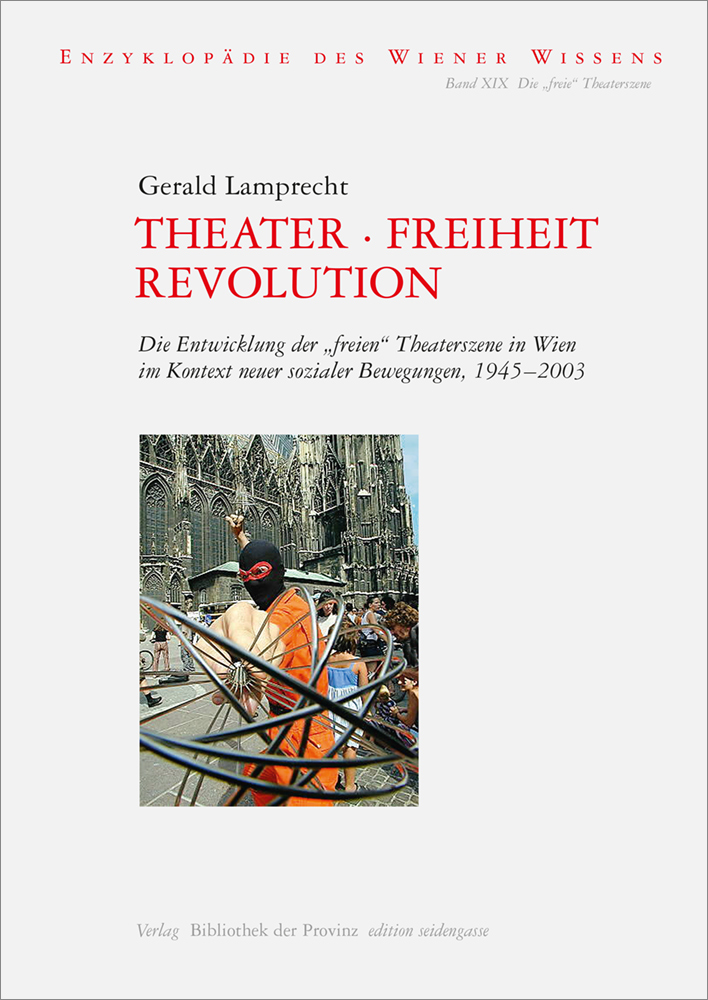
Theater · Freiheit · Revolution
Die Entwicklung der „freien“ Theaterszene in Wien im Kontext neuer sozialer Bewegungen, 1945–2003
Gerald Lamprecht
edition seidengasse: Enzyklopädie des Wiener WissensISBN: 978-3-99028-187-1
21 x 15 cm, 208 Seiten, Hardcover
€ 20,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
Dieser Band beleuchtet die Geschichte der „freien“ Theaterszene in Wien von 1945 bis zur Theaterreform 2003 als Teil jener „sozialen Bewegung“, die Wien in den 1960er und 70er Jahren aus seinem Dornröschenschlaf wachküsste.
Die „Ära Kreisky“ und die Arena-Besetzung veränderten spürbar das kulturelle Klima der Stadt. Die etablierten Theaterhäuser bekamen zunehmend Konkurrenz von den „jungen Wilden“, die ihre eigene Form des Theaters entwickelten. Die Stadt Wien begann die „Freien“ zu subventionieren und mit der Ernennung Peymanns zum Burgtheaterdirektor hielten die Arbeitsweisen und Ästhetiken der „Freien“ schließlich Einzug in die Burg. Die klassische Dichotomie zwischen Hoch- und Subkultur begann zu bröckeln und stürzte die „Freien“ in eine ideelle Krise.
Auf dem Weg ins neue Jahrtausend sah sich die „freie“ Theaterlandschaft mit neuen Thematiken konfrontiert: mit dem Stellenwert migrantischer Positionen in der Theaterlandschaft, einer Repolitisierung im Zuge der Globalisierungsproteste und der wachsenden Prekarisierung in der Arbeitswelt.
Wien genießt den Ruf einer Theaterstadt ersten Ranges. Jahr für Jahr ziehen etwa Burgtheater und Wiener Festwochen ein internationales Publikum an. Am Burgtheater spielen die „jungen Wilden“ von gestern und manchmal auch von heute, die Grenzen zwischen einer „unteren“ und einer „oberen“ Kultur scheinen fließender geworden zu sein.
Aber wer waren die Personen, die einst angetreten sind, um gegen die verkrusteten Wiener Staatstheaterstrukturen zu rebellieren? Was waren ihre Ideale und wie ging die Stadt Wien mit ihnen um? In Wien wie anderswo ging es jungen KünstlerInnen der 1960er und 70er Jahre unter dem Eindruck des Vietnamkriegs und im Bewusstsein, einer Tätergeneration zu entstammen, darum, die Welt zu verändern. So steht auch die Herausbildung einer „freien“ Theaterszene in Wien in einem engen Wechselspiel mit dem, was als „neue“ soziale Bewegungen bezeichnet wird.
Dem Aufbegehren der 60er und 70er Jahre folgte bald die Ernüchterung. Die Vision einer herrschaftsfreien Gesellschaft erwies sich als Utopie und so begann der „Marsch durch die Institutionen“. Oder aber, wie im Fall Wien, die Institution nahm sich der „Revoluzzer“ an, stellte ihnen Räume und Gelder zur Verfügung und hielt sie damit im Zaum. Gleichzeitig öffnete sich etwa das Burgtheater, vor allem unter Peymann, den alternativen Zugängen zum Theatermachen, was damals von Presse und Publikum in Österreich als skandalös wahrgenommen wurde.
Kann seither noch seriöserweise von „freiem“ Theater gesprochen werden? Und gibt es noch so etwas wie „soziale Bewegungen“? In den 90er Jahren, vor allem im Kontext der „alter-globalistischen“ Bewegungen, beginnt die „freie“ Theaterszene sich wieder – zumindest in Ansätzen – ihrer (politischen) Wurzeln bewusst zu werden. Kampffelder gibt es genug: prekäre Anstellungsverhältnisse, ein tendenziell rassistischer Grundtenor, Institutionen der Macht, denen persönliche Interessen zunehmend untergeordnet werden müssen.
Diese Arbeit zeigt die Entwicklung einer „freien“ Theaterszene von den Nachkriegsjahren bis zur Theaterreform 2003 und sucht dabei die Kontinuitäten und Diskontinuitäten der Dissidenz, der Autonomie und der Anpassung im „freien“ Theater.
[Enzyklopädisches Stichwort]
[edition seidengasse | Enzyklopädie des Wiener Wissens, Bd. XIX.
Begründet 2003 u. hrsg. von Hubert Christian Ehalt für die Wiener Vorlesungen, Dialogforum der Stadt Wien.]
