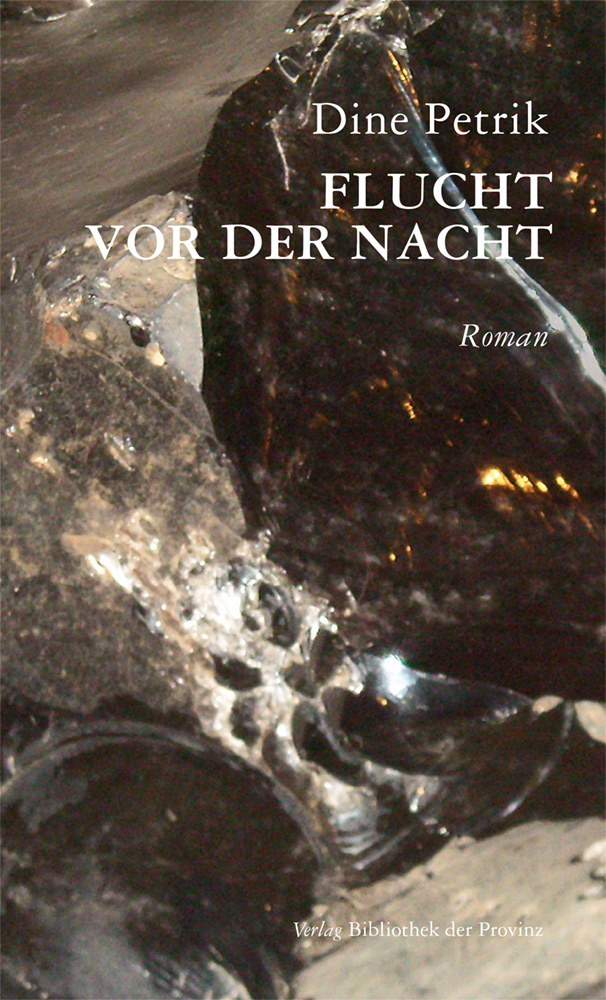
Flucht vor der Nacht
Roman
Dine Petrik
ISBN: 978-3-99028-367-7
19×12 cm, 196 Seiten, Klappenbroschur
20,00 €
Lieferbar
In den Warenkorb
Leseprobe (PDF)
Kurzbeschreibung
Er schluckte an seiner Wut, setzte kräftig nach. Über das leere Glas hinweg schielte er nach der Flasche. Ein dreister, zugleich infantiler Versuch der Annäherung. Eine Nähe, die nicht zu erreichen war. Er hatte sich längst entfernt, er war nicht da, er stand bloß herum. Ödes Geschwätz, was zum Teufel mache ich denn da. Mehr als ein Hm oder Aha hatte er sich bislang nicht abringen lassen. Weg da, raus, dachte er, während er sein Glas auffüllte. Sein Augenmerk galt dem schweren, ockerfarbigen Vorhang, der die halbe Zimmerfront von der Decke herab bis zum Parkett abdeckte. Schon war er, mit dem rechten Knie heftig gegen die Lamellen eines Heizkörpers stoßend, hinter dem Vorhand verschwunden. Einen Fluch zerbeißend, streifte er an der Fensterverglasung entlang: Na also, hier geht es raus. Aber nichts, der Türhebel in seiner Hand war nicht zu bewegen.
Rezensionen
Beatrice Simonsen: [Rezension]„Der Wunsch zu gehen ist die Flucht vor der Nacht, ist die Flucht vor der Angst.“ (S. 153) Gehen oder bleiben, im eigentlichen und im übertragenen Sinn: Soll man in der Stadt, bei dem Partner, in dem Haus, bei den Menschen und Dingen, die man sich erwählt hat, bleiben oder besser diese verlassen? Soll man überhaupt als letzten Ausweg aus dem Leben gehen oder sich doch diesem stellen – das ist die Grundfrage des neuen Romans von Dine Petrik.
Es ist ein in Angriff nehmen der letzten Fragen, denen sich besonders ein Mensch – die Hauptfigur des Romans – in ihrer ganzen Wucht stellt: Ben Bogathy, ein stadtbekannter Wiener Maler, ist ein Charismatiker mit schillerndem Leben, mit Preisen ausgezeichnet, Teil einer „Seitenblicke“-Gesellschaft, über den berichtet wird, wenn er mit einem Herzinfarkt ins Spital eingeliefert wird. Bogathy ist zugleich ein gutaussehender, geistreicher Verführer, aber auch ein Macho, der sich die Frauen nimmt und, so sie zum „Problem“ werden, sie wieder wegwirft. Mit ihm beginnt und endet der Roman, dazwischen spannt die Autorin ein festmaschiges Netz, das von Frauenfiguren getragen wird. Die Frauen ihrerseits – Bogathys Frau, seine Tochter, seine erste und seine zweite Geliebte – werden in ihren jeweiligen Beziehungen zum Hauptakteur dargestellt.
Catherine, die britische Ehefrau, ist unglücklich in Wien, verlässt den egozentrischen Künstler, kehrt heim nach London und nimmt das gemeinsame Kind mit. Olivia wird zum Stein des Anstoßes zwischen den beiden, der Vater leidet an ihrer Abwesenheit, sie wird später zum Kunststudium nach Wien zurückkehren, was ihr wiederum die Mutter übelnimmt. Es ist die altbekannte Fehde getrennter Eltern, die sie an den gemeinsamen Kindern ausleben. Olivia wird ausgerechnet an einem riesenhaften Obsidian, einem Stein, den die Mutter sich für ihre eigene künstlerische Arbeit erwählt hat, zugrunde gehen, nachdem sich schon eine Karriere im Licht (nicht im Schatten) des Vaters angekündigt hatte.
Die Ex-Geliebte Margarete Hörndlauer verkommt angesichts dieser Liebe des Vaters zur Tochter, entgegen all ihren magischen Selbstbeschwörungen, den wiederholten „Du hältst das aus!“, zur Rächerin der eigenen Erniedrigung. Die aus ländlichen Verhältnissen von Bogathy nach Wien Geholte überlebt mehr, als dass sie im von ihr heiß geliebten Wien wirklich lebt. Wohl hat sie sich gut eingerichtet, eine Arbeit gefunden, eine Wohnung, die ihr der joviale Ex-Liebhaber überlässt. Diese hat sie aus eigener Kraft renoviert, doch hält Bogathy die Situation mit einem bösen: „Kann sein, dass ich dieses Loch mal wieder brauchen werde …“ (S. 114) in Schwebe. Umsonst wartet Margarete auf ein anerkennendes Wort. Sie, die grob benutzt und zur Seite geschoben wurde, wie ein Möbelstück, hat Zeit genug nach Rache zu sinnen.
Dann ist da noch Edith, die aktuelle Geliebte, ganz ähnlich im Charakter wie Margarete, auch sie ist eine, die sich ihren Standpunkt, „Standfestigkeit!“, vorbeten muss um nicht zu kippen, um nicht an dem Koloss Bogathy zu zerbrechen. Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin gelingt es ihr jedoch die Schatten der Vergangenheit zu bannen. Kurz vor Schluss des Romans scheint sich alles ins Gute zu kehren, der Macho ist nach einem überlebten Herzinfarkt geläutert, Edith an seiner Seite – doch …
Es ist in spannender Roman voll von poetischen, farbigen Bildern, geistreichen Gesprächen über Kunst, geschichtstreuen Beschreibungen (Wiens) und starken Emotionen, die mittels innerer Monologe den Figuren eingeschrieben werden. Dabei wechselt die Autorin manchmal abrupt zwischen getragenem Pathos und Wiener Jargon, das hochliterarisch anmutende „wiewohl“ steht im Kontrast zu Ausdrücken wie „die tussige Wienerin“ (S. 34) oder „Angefressenes Schweigen.“ (S. 157) Es versinnbildlicht das Missverhältnis zwischen hehrem Kunststreben und groben Lebensverhältnissen.
Was die Konstruktion des Romangeschehens anbelangt, stellt die Autorin die Biographien ihrer Figuren vorerst nebeneinander bis sie preisgibt, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Dadurch entsteht ein Sog, der die Spannung aufrecht erhält. Auch sonst ist hier alles wiederzufinden, was das Schreiben von Dine Petrik charakterisiert: Das Geschichtsbewusstsein, die intensiven Bilder, der Stakkatoton in Höchstspannung, dazwischen eingestreute Skizzenhaftigkeit erinnern an frühere Arbeiten wie ihre bewährten Reiseerzählungen, die Hertha-Kräftner-Bücher, die lyrische Kraft.
(Beatrice Simonsen, Rezension im Buchmagazin des Literaturhaus Wien, veröffentlicht am 11. Mai 2015)
https://www.literaturhaus-wien.at/review/flucht-vor-der-nacht/
Hermann Schlösser: [Rezension]
„Flucht vor der Nacht“, der neue Roman von Dine Petrik spielt in der Wiener Kunstwelt. Im Zentrum des Geschehens steht ein ernstes, wenn nicht tragisches Psychodrama: Der arrivierte Maler Benjamin Bogathy hat in seiner Kunst viel erreicht (sein Kunstverständnis wird im Buch in vielen Gesprächen erörtert), doch schützt ihn das nicht vor Gefährdungen. Sein Ehe- und Familienleben ist eine einzige Katastrophe, in der schließlich die geliebte Tochter Olivia auf mysteriöse Weise ums Leben kommt. Auch Bogathy selbst, dem Alkohol verfallen, ist vom Tod bedroht. In einer Prosa, die innere Monologe und sachliche Beschreibungen ineinander verwebt, entwirft Petrik ein dichtes Zeitporträt, das im Jahr 2000 endet – also mit dem Beginn eines neuen Millenniums, das zumindest für einen Künstler wie Bogathy nichts Erfreuliches mehr zu bringen scheint.
(Hermann Schlösser, Rezension im „Extra“ der Wiener Zeitung vom 11. Juli 2015, S. 42)
Franz Schörkhuber: Stakkato einer Künstlerseele
Die Verweise auf James Joyce' Ulysses sowie auf Fjodor M. Dostojewskis Verbrechen und Strafe sind kein Zufall: In ihrem Roman Flucht vor der Nacht legt Dine Petrik die Abgründe einer vom Gewissen geplagten Seele frei, indem sie den Leser mit den Bewusstseinsströmen eines alternden Künstlers konfrontiert.
Das Buch kreist dabei um die Frage nach der Mitschuld am Unglück anderer, malt allerdings die Szenarien nicht genauer aus. Der Leser erahnt meist nur, was vorgefallen sein könnte: ein Ehebruch, eine erzwungene Abtreibung, ein sexueller Übergriff …
Diese Vagheit ist eine Stärke des Buchs. Aus den Leerstellen erwächst die Spannung, mit der man den Schicksalen folgt. Zwar ist der stenografische Stil, bei dem die Sätze oft ohne Verben bleiben, sperrig. Hat man sich aber einmal an die zuerst stockende, dann jäh lospreschende Privatsprache des Wiener Malers gewöhnt, tun sich dem Leser nach und nach die Gründe für dessen Zerrüttung auf.
Zu Beginn eine Andeutung: „Damals, dieser Schnitt. Dieser Stich ins Herz … Olivias Tod. Dieses Stechen, Toben in ihm … Diese totale Erschöpfung.“ Wer Olivia war, erfährt man zunächst noch nicht. Wohl aber, dass sich der berühmte Maler Ben Bogathy Schuld an ihrem Tod zu geben scheint: „Es kam nicht direkt auf ihn zu, es lauerte an der Ecke, es kam in den Träumen, es stand beim Rasieren im Spiegel: Schuldig! Sekundenlang wie ein Lähmung: In seinem Kopf dieses Klack!“
Auf „dieses Klack“ wird man während der Lektüre noch öfter stoßen. Genauso wie man auf vier Frauen trifft, deren Schicksale mit dem des Künstlers verwoben sind. Sich wieder der Form des inneren Monologs bedienend, entfaltet die Autorin nun deren Bewusstseinsräume. Leider gelingt es ihr dabei nicht, die unterschiedlichen Motive der Frauen auch in jeweils andere Sprachformen zu kleiden.
Abermals vernimmt man jenen abgehackten Ton, den man bereits von Ben her kannte und der sich bei der um ihr Kind betrogenen Margarete wie folgt anhört: „Ende zehnte, eher elfte Woche! Panik. Ein Schlag ins Gesicht, in den Magen. Angst und Panik. Eine Woche Zuwarten, schließlich das Telefonat. Er war sofort da. ‚Ausgeschlossen! Niemals! Niemals!‘“
Entbehrliche Wienreklame
Flucht vor der Nacht ist jedoch nicht nur das fesselnde Psychogramm eines Malers, sondern auch ein Buch über Wien. Wiederholt rühmen Olivia und Margarete die Museen, Plätze und Berge der Bundeshauptstadt. Schade ist nur, dass selbst hier die Autorin nicht von jenem Telegrammstil ablässt, der das gesamte Buch durchzieht. Was eine Hymne auf die Stadt sein könnte, liest sich dann wie ein Reiseführer, der in plakativen Termen ihre Sehenswürdigkeiten preist. „Sich Wien ergehen bis ins Innere“, sagt Margarete an einer Stelle. Indem man die Dinge wie wild mit Namen beschießt, erschließt sich aber noch nicht einmal deren Oberfläche.
(Franz Schörkhuber, Rezension im Standard vom 16. Juni 2015)
https://www.derstandard.at/story/2000017568678/stakkato-einer-kuenstlerseele
Beatrix Kramlovsky: Vier Frauen und ein Egomane
„Flucht vor der Nacht“: Dine Petriks kantiges Porträt eines schillernden Malers nebst Streiflichtern über die Wiener Künstlerszene zu Zeiten des Millenniums.
Ben Bogathy ist ein anerkannter Maler, ein wenig übers angeblich beste Alter hinaus. Er trinkt exzessiv, pflegt die Wiener Raunzerei, wenn er seine Meinung über Kollegen kundtun soll, ist ein getriebener Egomane. Edith, der er verdankt, dass „die Tage nichts Verheerendes“ mehr ausstrahlen, brüskiert er nicht nur auf Festen. Sie ist eine der Frauen, die er liebt, und der er das nicht sagen kann.
Mitten in dieser Oktobernacht, in der die Geschichte einsetzt, verlässt Ben die Gesellschaft und fährt zum Geburtstagsfest seines ältesten Freundes und Kollegen, Bruno Salcher. Mit wunderbar gesetzten Hinweisen flicht die 1942 im Burgenland geborene Dine Petrik Puzzleteile aus Bens Vergangenheit in den rasenden inneren Monolog des Malers.
Es sind karg bemessene Streiflichter, die Bens private Tragödien kurz erhellen. Der Unfalltod seiner studierenden Tochter Olivia, der Suizid seiner ersten Frau Catherine quälen ihn, der sich keiner Schuld bewusst sein will: Das flutende Glück der Arbeit. Und nagende Verlustgefühle. Und andere. Gefühle der Rache. Sie waren da, waren abzuarbeiten. Fast obsessiv: Frauen, sie provozieren das ja.
In Bens Furor mischen sich Vorurteile, die er als notwendiges Geländer nutzt, um sein Ego herausstreichen zu können. Die Frau aus der Provinz, Mag, die so verzweifelt versuchte, seine Einsamkeit zu erleichtern, hat für ihn keinen Wert. Dafür wird er einmal zahlen müssen. Edith schafft es allerdings, sich besser zu schützen und einen eigenen Weg zu finden.
Ben, von seinem Kunstanspruch zerfressen, drängt sich uns auf, weil Dine Petrik die richtige Stimme für ihn gefunden hat. Ihr von einigen Büchern bereits bekannter abgehackter Stil, die oft atemlos vorwärts stürmenden Rumpfsätze passen perfekt zu Ben. Seine Beobachtungen sind boshaft, ein wenig schief und oft unbarmherzig („Ihr Gesicht glühte, eine vom Alkohol aufgequollene Ampel, die abwechselnd die Brauen hob“). Notting (Hill), wohin Catherine mit Olivia zieht, nennt er abschätzig und verletzt „Nothing“. Nothing hat ihm die Tochter gestohlen, Nothing hat ihn amputiert.
Leider hat die seit 1959 in Wien lebende Autorin, deren Erzählen immer von starker Visualität geprägt ist, für Olivia, Mag und Edith keine eigenen Stimmen gefunden. Sie lesen sich wie weibliche Pendants zu Ben und sind doch ganz anders geplante Charaktere. Gerade die Stilelemente des inneren Monologs hätten für die Eigenständigkeit Möglichkeiten geboten.
Sowohl Olivia, die zum Vater für kurze Zeit zurückkehrt und irritiert ist von seinen Übergriffen, Mag, die Ben als Chance begreift, ihr Dorfleben beenden zu können, Edith, deren Rechnung erst nach Verlusten aufgeht, kreisen um Ben – leider in seinem Sprachduktus, was die Unterscheidung sehr erschwert. Ähnlich stilistisch angelegt sind Petriks Stadtbeschreibungen, die sich in Auflistungen erschöpfen, die zwar in manchen Details bös wahrhaftig sind, aber doch zu sehr an ein Baedeker-Verzeichnis für Wien erinnern, das es abzuarbeiten gilt. Das ist schade.
Dine Petriks Buch hätte nämlich das Zeug gehabt, ein spannender Roman über Künstler in Wien und die Szene zu Zeiten des Millenniums zu werden: Frauen rund um einen Egomanen, in einem modern angelegten Expressionismus mit sorgsam eingeflochtenen Austriazismen. Nun ist es das kantige Porträt eines Schillernden, das sich auf einer Leinwand voll wildem Farbgemenge hervorhebt.
(Beatrix Kramlovsky, Rezension in der Presse vom 3. Oktober 2015)
https://www.diepresse.com/4834778/vier-frauen-und-ein-egomane
Wolfgang Ratz: [Rezension]
Petrik konfrontiert uns in ihrem jüngsten Roman mit einer dramatischen Negativbilanz an der Jahrtausendwende. Die Zentralperson des Buchs, Ben Bogathy, ein gealterter Star des Kunstbetriebs erlebt eine wahre Höllenfahrt, wobei hier die Hölle nicht nur die anderen sind. In „seinen“ Abschnitten, denn von den vierzehn Kapiteln sind einige auch aus anderen, nämlich weiblichen Perspektiven geschrieben, brüllt er seinen Ekel über die Belang- und Formlosigkeit der geldgierigen Szene atemlos heraus. Die Trauer um menschliche Verluste schwemmt er mit Alkohol hinweg. Doch trotz alledem bleibt er ein sinnenfreudiger Maler, für den Frauen Triebkräfte seines Lebens und Schaffens sind.
„Flucht vor der Nacht“ berührt einige Genres, so den klassischen Künstlerroman mit Bogathys Ansichten zur Moderne und Postmoderne in der bildenden Kunst, das Schicksalsdrama, in dem fast sadistisch jede mögliche Wendung zum Besseren vereitelt wird, schließlich auch den Psychothriller, wo die zurückgewiesene Liebeskraft einer Frau in kriminelle Energie umschlägt. Sogar als Schlüsselroman könnte man „Flucht vor der Nacht“ lesen – und gründlich missverstehen, denn mögen auch einzelne Personen der Handlung aus der österreichischen Szene entlehnt sein, bleiben sie doch nur Nebenfiguren im Psychoschach.
Bogathy, dessen dauernd drohenden Absturz der Leser hautnah mitverfolgt, wird trotz seines verzweifelten Kampfes für (s)ein Glück und gegen das ihn unerbittlich verfolgende Verhängnis nicht recht sympathisch. Frauen sind ihm, so scheint es, Mittel zum Zweck, Muse oder Jungbrunnen, Füllstoff der Leere. Von „erfrischenden One-Night-Stands“ ist die Rede.
Dennoch: Sein Leben verbrennt an den Tragödien seines Lebens: Catherine, die ihn und Wien verlässt und mit Tochter Olivia nach London zurückkehrt, und die hochbegabte Tochter, die als Erwachsene zum Vater nach Wien kommt, wo sich ein Idyll zu entfalten verspricht, bis das Schicksal zuschlägt. Wie sich die Tragödien im Detail abgespielt haben, wird größtenteils angedeutet und bleibt letztendlich der Deduktion oder Phantasie des Lesers überlassen. Die Schuld, die sich Bogathy zu Recht oder Unrecht gibt, verzehrt ihn aber, treibt ihn vor sich her. Ein riesiger schwarzer Obsidian wird zum Symbol und Corpus delicti zugleich, scheint fast magisch Unheil über Bogathy und seine Familie zu bringen.
In dieser Situation tritt Edith in sein Leben, seelische Heilung scheint möglich, auch eine Abwendung vom Alkohol ist für Bogathy nach einem völligen Zusammenbruch plötzlich das Gebot der Stunde. Eine Neugeburt aus der Kraft der Liebe. Doch da ist auch noch Margarete, die Provinzlerin, die Affäre, der Bogathy nie reinen Wein eingeschenkt hat. Sie beobachtet Bogathy aus der Ferne und entgleist völlig angesichts des Glücks ihres früheren Geliebten.
Schuld und Schicksal, große Themen, vor denen man sich heute scheut. Petrik vermeidet Pathos durch eine zerrissene, splitternde Sprache, die die wechselnden Perspektiven mit einem flackernden Helldunkel überzieht. Eine furiose und wie von Furien gejagte Stimme, ein großes Wüten und großes Mitleiden zugleich.
(Wolfgang Ratz, Rezension in: Podium #177/178, November 2015)
Helmuth Schönauer: [Rezension]
Letztlich sind viele Typen prädestiniert, sich vor der Nacht zu fürchten. Die Kinder, wenn sie mit Gruselprogramm zu Bett gebracht worden sind, die erotisch Inspirierten, wenn das Tun nicht mehr mit dem Wollen übereinstimmt, die Künstler, wenn sie in der Finsternis dem aufgeklärten Licht ihrer Werke entrückt sind.
Dine Petrik nimmt diese Flucht vor der Nacht zum Anlass, um einen Künstler anlässlich des Millennium-Sprungs Bilanz ziehen zu lassen. Dabei wird nicht nur der kaputte Maler seziert, auch die Gesellschaft der Adabeis und die ganze Hautevolee kommen anlässlich der Silvesternacht 2000 an ihre Grenzen und werden somit an die Finsternis herangeführt.
Vom Plot her gesehen handelt es sich vor allem um den Künstlerroman eines kaputten Genies. Zu Beginn zieht eine angetrunkene Gesellschaft durch die Hotspots einer Wiener Galeristen-Szene. Am Ende stehen die Typen in der Kippe zum neuen Jahrtausend und trauen sich nicht so recht drüber.
Protagonist ist der Maler Ben Bogathy, der zwischen Wien und London künstlerisch und erotisch hin und herpendelt. Allmählich hat er den Überblick verloren, seine Affären und Partnerschaften sind ihm über den Kopf gewachsen, er kriegt ein dementsprechendes Alkoholproblem, und der Zusammenbruch dient dazu, ein bisschen Klarheit zu schaffen.
Im Vollrausch prosten sich Ben und sein Kollege Armin in die Klarheit. „Catherine, meine Ex ist tot, die Geliebte ist Edith, und wer ist Olivia?" (151)
Aus der Sicht der Frauen schaut die Sache ganz anders aus, zwar wissen sie oft selbst nicht, warum sie sich diesen Wirbel antun. Was aus der Sicht des Genies eine große Geste ist, fällt für die Frauen recht handfest und ruppig aus. Am Beispiel einer Abtreibung kommt die Rollenverteilung in Schieflage. Der Mann brüllt etwas von Ruin, das muss weg, dann wird die Summe für den Eingriff auf Kredit aufgenommen und anschließen halbe-halbe gemacht. Die Frau empfindet das zwar als ungerecht, aber es ist so, wenn Genie auf Frau trifft.
Über diesen Künstlerroman ist freilich ein Kunst-Beadeker gelegt. Es gibt kaum ein Zusammentreffen der Helden, wobei nicht eine Kunsttheorie diskutiert würde, kaum eine Straßenecke, wo nicht interessante Architektur zum Vorschein kommt und kaum eine Liebschaft, wo nicht ernsthaft über den Sinn des Zusammenseins und Auseinandergehens diskutiert würde. Auch hier fürchten die Beteiligten oft um den Verstand, weil eine Nacht intensiver sein kann als der Tag. (171)
Im heftigsten Schlamassel und in den größten Enttäuschungen glauben die Protagonisten freilich daran, dass sich das Leben im gebildeten Zustand besser aushalten lässt. Deshalb wird ständig herumgefahren, studiert, absolviert und emigriert in der Hoffnung, dass die Welt besser wird, wenn man sie studiert. So gesehen kann das Ende auch ein optimistischer Sprung ins neue Jahrtausend sein, eine Flucht heraus aus der Nacht der Vergangenheit.
(Helmuth Schönauer, Gegenwartsliteratur #2473, veröffentlicht am 17. Mai 2016)
https://lesen.tibs.at/content/erwachsene/dine-petrik-flucht-vor-der-nacht
Beatrice Simonsen: [Rezension]
Mit ihrem ersten Roman „Flucht vor der Nacht“ erweitert Dine Petrik ihr Werk um eine neue Facette. In der Kraft der Gefühle und der Farbigkeit der Darstellung ist sie sich treu geblieben, auch in ihrem Interesse für die Darstellung von Spuren alter Kulturen, von Stadträumen und Kunstwerken. Vielleicht aus diesem Interesse stellt die Autorin einen bildenden Künstler, einen Maler, ins Zentrum des Romans.
Zugleich beschäftigt Dine Petrik aber eine andere, existentielle Frage: Gehen oder bleiben, im eigentlichen und im übertragenen Sinn. Soll man in der Stadt, bei dem Partner, in dem Haus, bei den Menschen und Dingen, die man sich erwählt hat, bleiben oder besser diese verlassen? Soll man überhaupt als letzten Ausweg aus dem Leben gehen oder sich doch diesem stellen? Dieser letzten Frage in ihrer ganzen Wucht stellt sich besonders einer, die Hauptfigur des Romans: Ben Bogathy, ein stadtbekannter Wiener Maler. Er ist ein Charismatiker mit schillerndem Leben, mit Preisen ausgezeichnet, Teil einer „Seitenblicke“-Gesellschaft, über den berichtet wird, wenn er mit einem Herzinfarkt ins Spital eingeliefert wird. Bogathy ist ein gutaussehender, geistreicher Verführer, ein Macho, der sich die Frauen nimmt und, wenn sie zum „Problem“ werden, wieder wegwirft. Mit ihm beginnt und endet der Roman, sein Leben, seine Gedanken, seine Irrwege durch das nächtliche Wien bilden das Gerüst, das mit den Biographien seiner Frauen zu prallem Leben aufgefüllt wird. „Die Frauen“, das sind Bogathys Ex-Ehefrau, seine Tochter, seine erste Ex- und seine zweite aktuelle Geliebte – sie werden in ihren jeweiligen Beziehungen zum Hauptakteur dargestellt.
Catherine, die britische Ehefrau war unglücklich in Wien, sie verließ den egozentrischen Künstler, kehrte heim nach London und nahm die Tochter mit. Was aus einer gescheiterten Beziehung zurückbleibt, sind die gemeinsamen Kinder – in diesem Fall ist es Olivia, die von beiden Elternteilen umworben, jeweils auf die eine oder die andere Seite gezerrt, um deren Gunst gebuhlt wird. Der Vater leidet schwer an dem erzwungenen Verzicht auf seine Tochter und spielt doch sofort seine Macht aus, sobald diese zum Kunststudium nach Wien zurückkehrt und er sie unter seine Fittiche nimmt. Dine Petrik zeigt mit psychologischem Feingefühl seinen Zwiespalt: Die Tochter ist die einzige, die der Vater nicht in seine gängigen, fast gewalttätigen Beziehungsmuster Frauen gegenüber zwängen will. Und doch schwankt er beständig zwischen Stolz und Anerkennung einerseits und Drohung und Bevormundung andererseits. Was hier nicht ganz gelingt, ist die Stimme Olivias, der mit weitschweifigen Ausführungen über die Stadt Wien ein etwas altbacken wirkendes Interesse an Geschichte angedichtet wird. Doch bleibt die Handlung spannend, denn die Autorin lässt die junge Frau gerade dann, als sich schon eine Karriere im Licht (nicht im Schatten) des Vaters ankündigt, scheitern. Ein riesenhafter Obsidian, ein roher Stein, den die Mutter für ihre bildhauerische Arbeit vorbereitet hat, wird ihr zum Verhängnis – im übertragenen Sinn könnte man meinen, dass das Kind am versteinerten Verhältnis der Eltern zerbricht.
In dieses enge Familienverhältnis schaltet sich schon bald eine neue Stimme ein und zwar jene der Ex-Geliebten Margarete, die angesichts der machtvollen Liebe des Vaters zur Tochter verkümmert, entgegen all den magischen Selbstbeschwörungen, den wiederholten „Du hältst das aus!“, und zur Rächerin ihrer Erniedrigung wird. Die aus ländlichen Verhältnissen von Bogathy nach Wien Verfrachtete liebt diese Stadt zwar inbrünstig, wird ihr aber doch nicht gerecht. Wohl hat sie sich gut eingerichtet, eine Arbeit gefunden, eine Wohnung, die ihr der joviale Ex-Liebhaber überlässt. Umsonst wartet sie auf seine Wiederkehr, zumindest auf ein anerkennendes Wort. Sie, die grob benutzt und zur Seite geschoben wurde wie ein Möbelstück, hat Zeit genug nach Rache zu sinnen. Ihre Nachfolgerin Edith, die aktuelle Geliebte, ist ganz ähnlich im Charakter wie Margarete, auch sie ist eine, die sich ihren Standpunkt – „Standfestigkeit!“ – vorbeten muss um nicht zu kippen, um nicht von dem Koloss Bogathy erdrückt zu werden. Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin gelingt es ihr jedoch die Schatten der Vergangenheit zu bannen. Kurz vor Schluss des Romans scheint sich alles ins Gute zu wenden, der Macho ist nach einem überlebten Herzinfarkt geläutert, Edith an seiner Seite – doch …
Im für die Autorin typischen Stakkato-Ton werden – allerdings wenig variiert – den Figuren mittels innerer Monologe Emotionen, Stimmungen eingeschrieben. Dazwischen überrascht ein abrupter Wechsel zwischen getragenem Pathos und Wiener Jargon, der vielleicht das Missverhältnis zwischen hehrem Kunststreben und groben Lebensverhältnissen versinnbildlichen soll. Vor dem Hintergrund der Wiener Millenniumsfeiern im Jahr 2000 werden Gespräche über Kunst und (kunst)historische Stadtbeschreibungen in die Handlung eingebettet, sodass ganz nebenbei ein informativer Mehrwert entsteht.
Was die Konstruktion des Romangeschehens anbelangt, lässt die Autorin die Stimmen ihrer Hauptfiguren in den aufeinanderfolgenden Kapiteln erklingen, ohne gleich ihre Position, ihr Verhältnis zu den anderen preiszugeben. Das macht neugierig und es entsteht ein Sog, der die Spannung bis zum Schluss aufrecht erhält. Das Besondere des Romans ist aber die Wahl des Künstlermilieus: Literarisch über Kunst zu schreiben ist kein simples Unterfangen, aber Dine Petrik gelingen gerade diese Passagen der Bildbeschreibungen, der Schaffenskrisen, der Selbstzweifel, der Euphorien und jene, in denen Künstler, Kritiker, selbsternannte Kunstkenner, Freunde und Feinde – alle selbstverständlich auch in weiblicher Form gemeint – ihre Standpunkte zur Kunst vertreten.
(Beatrice Simonsen, Rezension in: Literatur und Kritik #501/502, März 2016)
Weitere Bücher des Autor*s im Verlag:
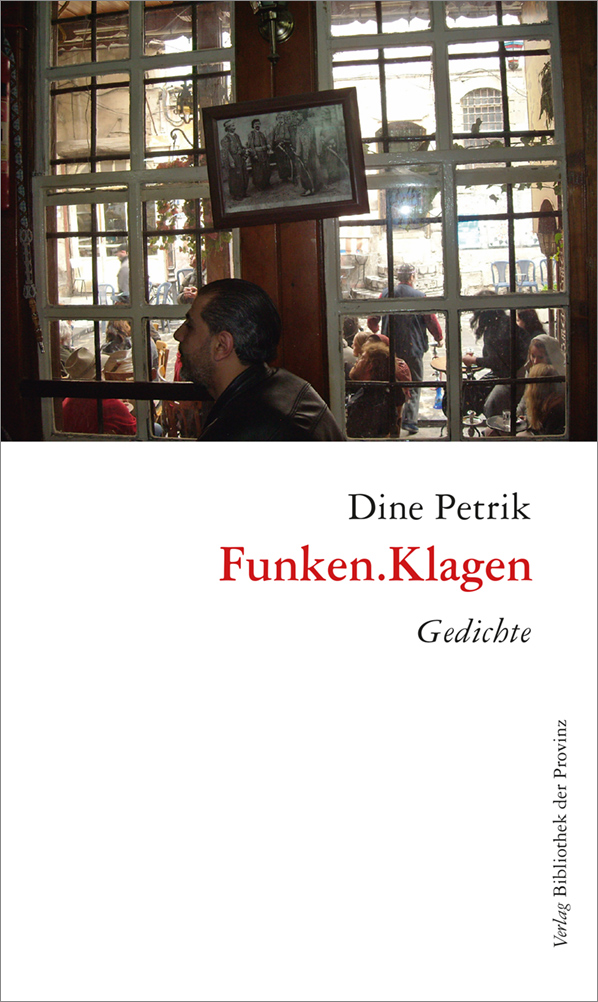
Funken.Klagen
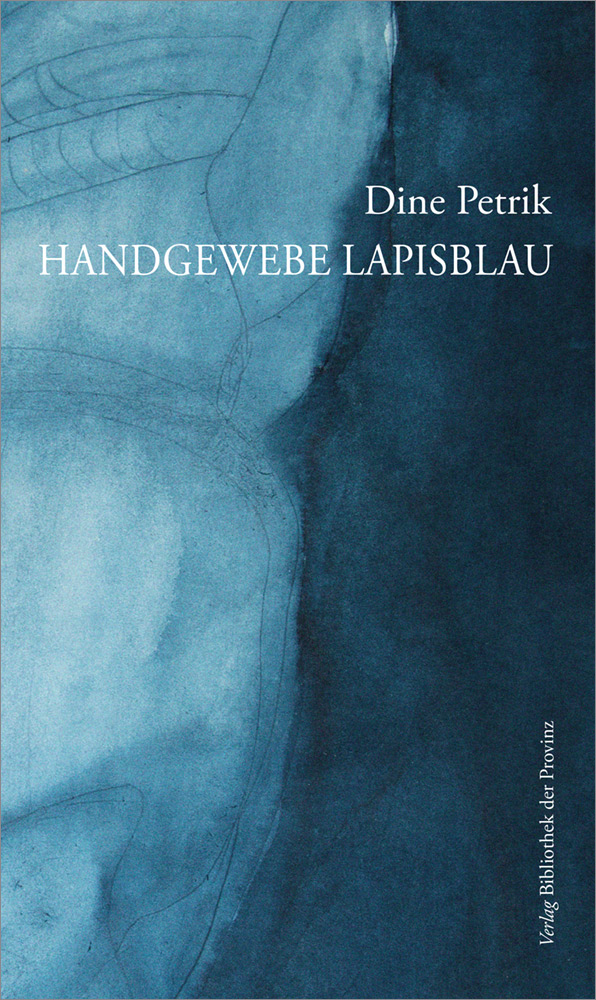
Handgewebe lapisblau
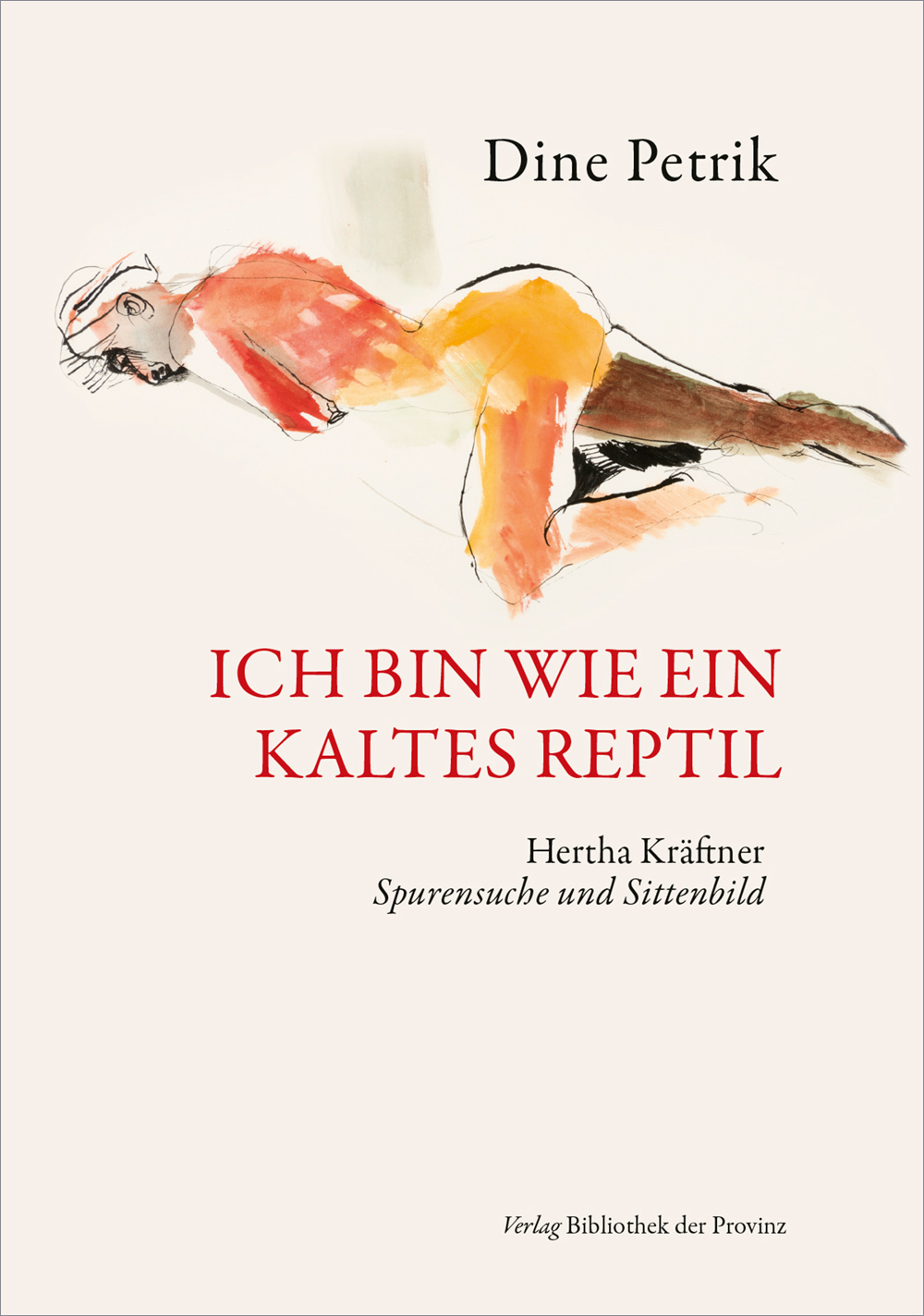
Ich bin wie ein kaltes Reptil
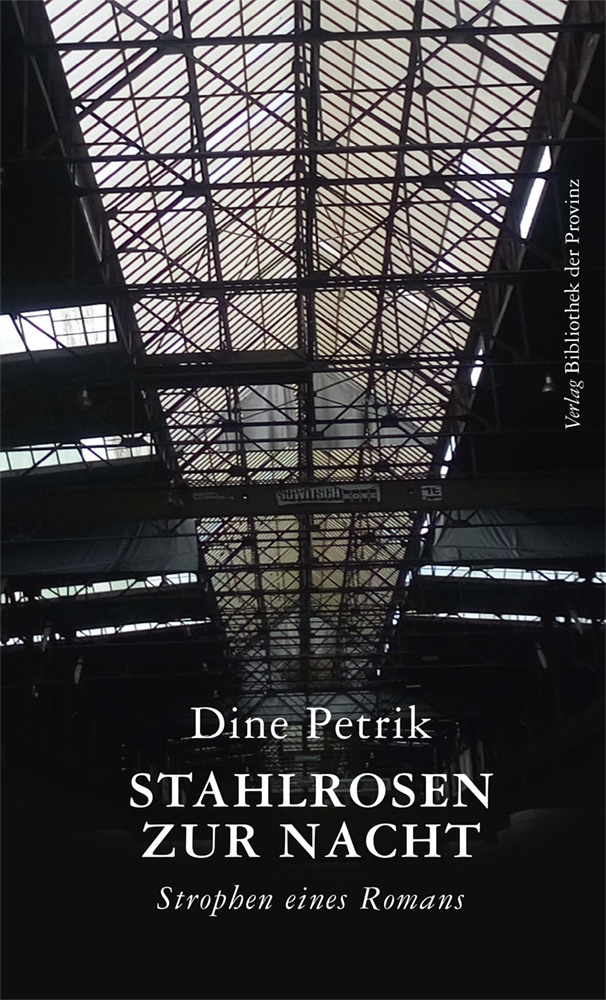
Stahlrosen zur Nacht
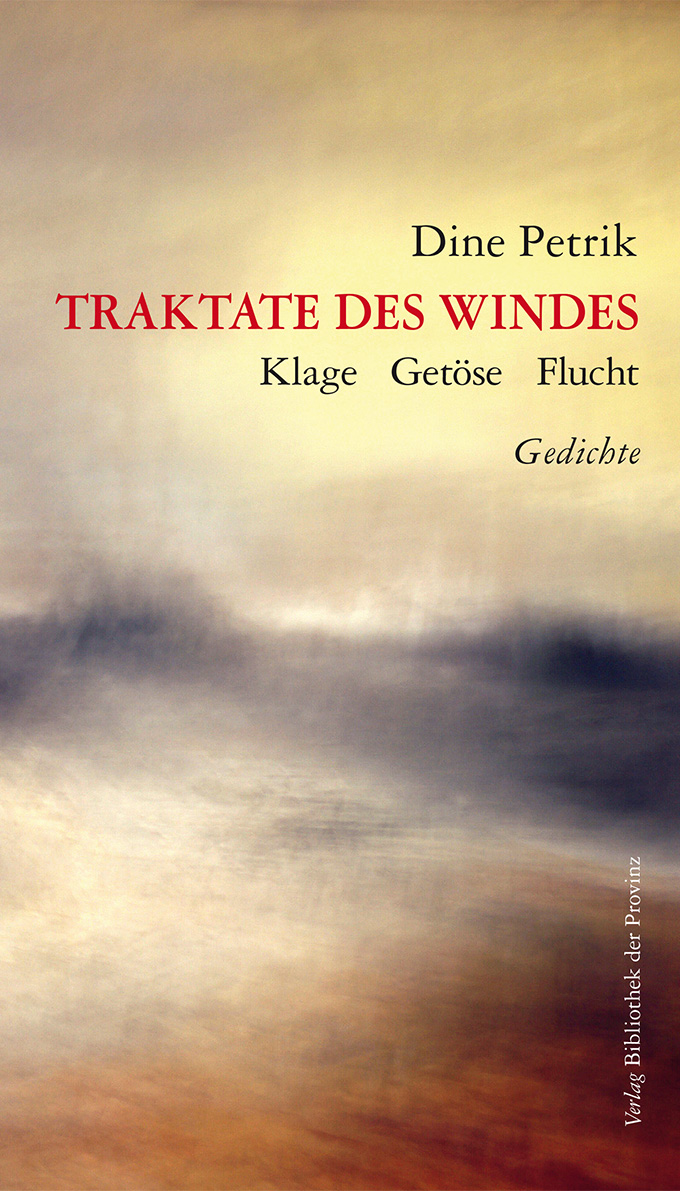
Traktate des Windes
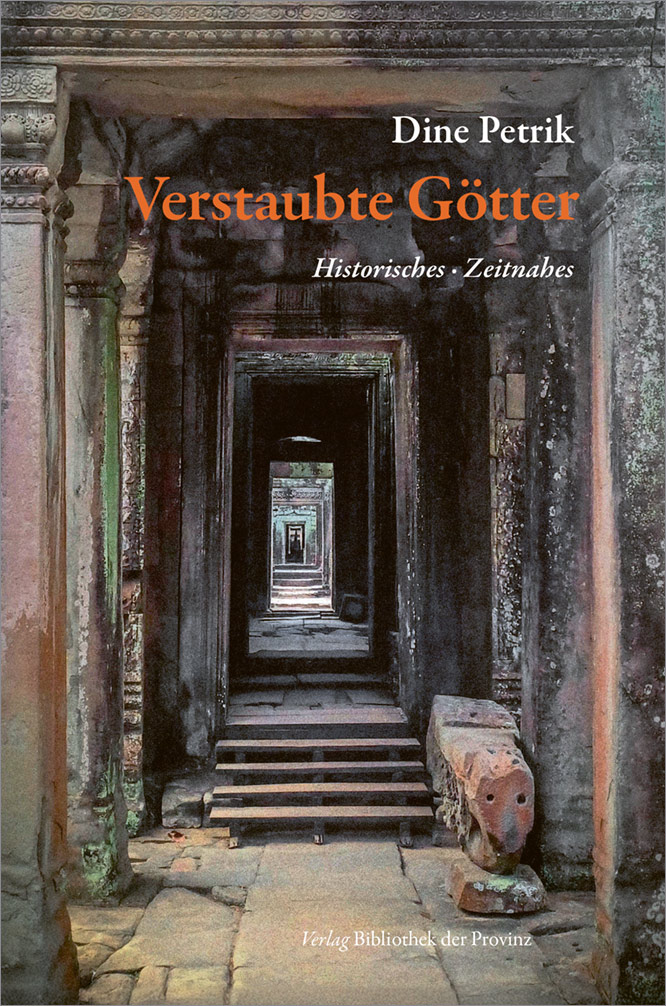
Verstaubte Götter
